Inklusion war in den vergangenen Jahren eines der Reizthemen in bildungspolitischen Diskussionen. Vor allem im Hinblick auf Gymnasien wurde dabei oft in Frage gestellt, ob das gemeinsame Lernen überhaupt funktionieren kann. Die wichtigere Frage ist aus meiner Sicht: Unter welchen Rahmenbedingungen kann Inklusion gelingen? Auf der Basis meiner Erfahrungen in einer Inklusionsklasse an einem Gymnasium versuche ich diese Frage zu beantworten.
Montag Morgen, 1. Stunde. Chemie-Unterricht in einer 7. Klasse: Manche Schüler*innen halten Reagenzgläser in den rauschenden Gasbrenner und warten gespannt auf eine chemische Reaktion. Ein paar Schüler*innen sind abgelenkt und reden über ihre Wochenend-Erlebnisse. Eine Schülerin ruft eine Beleidigung quer durch den Raum und wird vom Lehrer ermahnt. Eine reguläre Klasse an einem Gymnasium in NRW könnte man meinen.
Der erste Eindruck trügt jedoch – es handelt sich um eine Inklusionsklasse. Neben den Regelschüler*innen lernen in dieser 7. Klasse auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Es gibt Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Lernen, denen es schwer fällt zu lesen und komplexe Sachverhalte zu verstehen. Es gibt Schüler*innen mit ADHS, die sich nicht gut konzentrieren können. Und es gibt Schüler*innen mit Asperger-Autismus, für die es eine Herausforderung ist, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Dazu kommen noch zwei Kinder, die aus Kriegsgebieten nach Deutschland geflüchtet sind und noch dabei sind, Deutsch zu lernen.
Inklusion hilft Kindern dabei, gesellschaftliche Barrieren zu überwinden
Dass die Heterogenität in der Klasse nicht auf den ersten Blick auffällt, liegt daran, dass die Inklusion in der Klasse immer wieder gut gelingt, wenn man genau hinschaut: So kann man beobachten, wie ein Junge mit den Diagnosen ADS und Autismus aufopferungsvoll und geduldig einem Jungen aus Syrien die Chemie-Experimente erklärt. Wie sich das erste Liebespaar der Klasse über die Inklusions-Grenzen hinweg bildet. Oder wie bei einer Projektarbeit alle Inklusionskinder wie selbstverständlich in unterschiedlichen Gruppen mit Regelschüler*innen arbeiten, ohne dass die Lehrer einen Beitrag leisten müssen. Inklusion erlaubt es den Schüler*innen, die mehr oder weniger willkürlichen Grenzen zu überwinden, die Erwachsene nicht zuletzt durch das differenzierte Schulsystem gezogen haben.
Solche Erfahrungen lassen mich hoffen, dass Inklusion eine Chance ist, Barrieren in unserer Gesellschaft zu überwinden, ohne dass dabei das fachliche Lernen leiden muss. Natürlich stoßen wir Lehrer*innen auch in dieser Klasse auf Probleme und nicht alles gelingt reibungslos. Aber doch habe ich das Gefühl, dass wir als Lehrer diesen Herausforderungen ähnlich gut begegnen können wie in den Regel-Klassen. Genau diese Normalität des gemeinsamen Lernens macht diese 7. Klasse zu einer Erfolgsgeschichte, denn sie ist das Ziel der Inklusion.
Mein Fazit nach einem halben Jahr Tätigkeit in einer Inklusions-Klasse an einem Gymnasium ist daher: Inklusion kann gelingen. Entscheidend dafür sind aber die organisatorischen Rahmenbedingungen. Insofern möchte ich am Beispiel der 7. Klasse vorstellen, welche Rahmenbedingungen nötig sind, damit Inklusion am Gymnasium funktioniert und inwiefern diese leider in aller Regel nicht erfüllt sind.
Die Klassengröße: Weniger ist mehr
Ich habe vor einer Weile in einem Blog-Beitrag anhand eines fiktiven Oberstufen-Kurses beschrieben, wie groß die Heterogenität in Lerngruppen auch am Gymnasium ist. Schon 30 Schüler*innen zu unterrichten ist eine nahezu unmöglich zu meisternde Herausforderung, wenn man den Anspruch hat, allen Kindern gerecht zu werden. Haben dann noch einige einen sonderpädagogischem Förderbedarf ist das Unterfangen, guten Unterricht für alle zu machen aussichtslos. Es erleichtert uns die Arbeit deswegen sehr, dass die I-Klassen bei uns etwas kleiner ist und nur aus 25 Schüler*innen besteht.
Das Problem: Inklusionsklassen sind oft so groß wie Regelklassen
Die Realität an vielen Schulen sieht aber anders aus: So gaben bei einer Forsa-Umfrage von 2016 48 Prozent der befragten Lehrer*innen an, dass die Klassengröße nicht reduziert worden sei.
Das liegt auch daran, dass grundsätzlich für die Größe von Inklusionsklassen die gleiche Obergrenze gilt wie für Regelklassen: Diese liegt in diesem Schuljahr in Gymnasien und Gesamtschulen bei 29 bzw. 30. Und diese Kennzahl muss in der Regel auch ausgeschöpft werden – alleine schon weil in vielen Kommunen Schulplätze fehlen. Experten und Lehrerverbände fordern daher schon lange gesonderte Obergrenzen für Inklusionsklassen. Laut der Website des Kultusministeriums wird es eine generelle Begrenzung auch künftig nicht geben.
Doppelbesetzung: Unterrichten im Tandem ist gut für alle
Ein Grund für die fehlende Begrenzung der Klassengröße ist laut der Landesregierung, dass in Inklusionsklassen die Lehrer regelmäßig in Doppelbesetzung unterrichten. Auch ich unterrichte mit einem Kollegen zusammen: Wir haben uns bewusst dafür entschieden gemeinsam zu unterrichten. Denn wie für viele andere Tätigkeiten gilt auch im Lehrer-Team: Die Zusammenarbeit geht leichter von der Hand, wenn die Team-Mitglieder gerne zusammen arbeiten und ähnliche pädagogische Ziele verfolgen.
Die Doppelbesetzung ist in den Inklusionsklassen von besonderer Bedeutung: Die Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen oft je nach Förderschwerpunkt und individuellen Besonderheiten besondere Zuwendung. Diese individuelle Betreuung ist natürlich deutlich leichter zu bewerkstelligen, wenn man zu zweit im Klassenraum ist.
Aber auch die Regel-Schüler*innen profitieren stark vom Lehrer-Tandem. Gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht ist der Betreuungsbedarf groß: Die Schüler*innen arbeiten häufig selbständig in Experimenten oder Projekten. Diese Arbeitsformen sind als Lehrer sehr fordernd, weil sie eine deutlich höheren individuellen Betreuungsaufwand bedeuten: Viele Schüler*innen haben Fragen oder brauchen Unterstützung. Zu zweit ist es viel einfacher möglich allen Schülern gerecht zu werden.
Teamarbeit mach den Unterricht aber auch besser: Im Team Unterricht zu planen, erhöht merklich die Kreativität. Die Arbeitsteilung erleichtert es zudem differenzierte Aufgaben und Materialien zu entwickeln, die für möglichst jedes Kind angemessene Herausforderungen bieten. Und nicht zuletzt lassen sich Fehler bei der Unterrichtsplanung leichter vermeiden.
Zudem erlaubt die Doppelbesetzung gleichzeitig auch eine genauere Diagnose des Arbeitsverhaltens. Alleine ist man als Lehrer oft schon mit den Fragen der jungen Menschen vollständig ausgelastet. In Doppelbesetzung kann sich ein Team-Mitglied zeitweise heraus ziehen, um das Arbeitsverhalten der Schüler*innen genauer zu beobachten. Das ist zum einen wichtig, um Teams hinsichtlich ihrer Kooperation zu beraten. Zum anderen erlaubt das aber auch eine fairere Bewertung, da nun nicht nur das Ergebnis einer Arbeitsphase, sondern auch der individuelle Anteil jedes Einzelnen berücksichtigt werden kann.
Und nicht zuletzt erhält man auf diesem Weg als Lehrer viel öfter ein professionelles Feedback. Nach dem Referendariat bekommt man als Lehrer nur noch selten Besuch. Durch die zunehmende Routine schleichen sich dabei naturgemäß Verhaltensmuster ein, die für das Lernen nicht förderlich sind. Die Doppelbesetzung kann hier helfen.
Das Problem: Doppelbesetzung ist (und bleibt) nicht der Regelfall
Dass durchgehende Doppelbesetzung eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Inklusion ist, daran zweifelt kaum jemand. Genauso wenig Zweifel lassen aber Politiker daran, dass diese auch künftig nicht zum Standard werden wird: Sie verweisen immer wieder entweder darauf, dass Doppelbesetzung nicht notwendig, zielführend oder nicht zu finanzieren ist. Ich und meine Tandempartner haben schlichtweg Glück gehabt, dass uns die Schulleitung unseren Wunsch zusammenarbeiten, erfüllen konnte. Aber auch an unsere Schule reichen die Stundenkontingente schlichtweg nicht aus, um eine dauerhafte Doppelbesetzung zu realisieren.
Sonderpädagogen bringen besonders Know-How ein
Im Klassenteam der 7. Klasse ist auch eine Sonderpädagogin. Diese ist mit vielen Stunden als Doppelbesetzung im Unterricht dabei. Naturgemäß geht das nicht in allen Stunden. Aber auch für Kollegen wie mich, die auf ihre Unterstützung im Unterricht verzichten müssen, steht sie mit Rat und Tat zur Seite – zum Beispiel wenn es darum geht, differenzierte Lernmaterialien zu erstellen.
Diese Unterstützung ist unerlässlich – gerade am Gymnasium. Differenzierung und Individualisierung sind zwar natürlich Teil der Aufgabe von Lehrer*innen auch an dieser Schulform. Regelschul-Lehrer lernen in der Regel aber weder im Studium noch im der Ausbildung im Referendariat etwas über die besonderen Bedürfnisse der Kinder mit Förderbedarf. Deshalb ist es unerlässlich, mit den Sonderpädagog*innen zusätzliche Expertise im Team zu haben. Das gilt insbesondere an Gymnasien, an denen die Lehrer*innen an eine vermeintlich vergleichsweise homogene Schülerschaft gewöhnt sind.
Das Problem: Es fehlen Sonderpädagog*innen
Wie stark die Lehrer*innen in Inklusionsklassen von Sonderpädagog*innen unterstützt werden, unterscheidet sich stark von Schule zu Schule. Ein Grund: In NRW fehlen Sonderpädagogen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) beziffert die Lücke auf 7.000 Lehrer*innen. Doch der Mangel zeigt sich schon jetzt: So kommt es immer wieder vor, dass sich auf ausgeschriebene Stellen für Sonderpädagog*innen keine einzige Bewerbung erfolgt.
Klassen-Team: Team-Work erfordert Team-Zeit und Team-Building
Selbst wenn eine Schule die Stellen für Sonderpädagog*innen besetzen kann, heißt das nicht, dass die Kooperation funktioniert. Sonderpädagog*innen und Lehrer*innen an Regelschulen müssen lernen, produktiv zusammen zu arbeiten. Umso wichtiger ist ein regelmäßiger Austausch und Zeit zum Kennenlernen und zur gemeinsamen Planung von Unterricht.
An unserer Schulen gibt es für die Inklusionsklassen Team-Zeiten. Die Treffen sind in unserem Team bei allen Kollegen zu einer verträglichen Zeit fest im Stundenplan verankert und den Team-Mitgliedern wird dafür auch eine halbe Stunde in ihrem Deputat gut geschrieben.
Das Problem: Keine Zeitfenster für Austausch
Solche Team-Zeiten sind leider kein Regelfall – nicht alle Schulleitungen ermöglichen sie. Und im normalen Schulalltag ist es aus organisatorischen Gründen so gut wie unmöglich sich als Klassen-Team regelmäßig zu treffen. Auch an unserer Schule ist es für einige Inklusions-Teams und die Stundenplan-Macher nicht möglich, gute Team-Zeiten zu finden: Einige Gruppen tagen deshalb in der Mittagspause oder in der 9./10. Stunde.
Unter solchen Umständen leidet die selbstverständlich die Zusammenarbeit. Fehlt aber die dringend nötige Abstimmung im Klassenteam, leidet darunter die individuelle Betreuung der Kinder und Qualität des Unterrichtes. Lösungen für dieses Problem liefert die Landesregierung leider meines Wissens nicht.
Inklusionsbegleiter: Entlastung für Lehrer*innen
In vielen Inklusionsklassen sind die Lehrer*innen nicht die einzigen Erwachsenen im Raum. Denn einige der Kinder mit Förderbedarf haben sogenannte Inklusionsbegleiter*innen. Diese Integrationshelfer sind einzelnen Schülern zugeordnet und sollen ihnen dabei helfen ihren Schulalltag zu bewältigen.
Der Idealfall der Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen und Inklusionsbegleiter*innen lässt sich in meiner 7. Klasse beobachten: Unsere beiden Inklusionsbegleiter*innen geben uns nicht nur gute Hinweise über den richtigen Umgang mit ihren Schützlingen. Sie haben genauso den Rest der Klasse im Blick. Insofern sind sie dadurch eine weitere Entlastung für die Lehrer*innen.
Das Problem: Inklusionsbegleiter ist nicht gleich Inklusionsbegleiter
Nicht alle Schulbegleiter sind eine gute Hilfe. Da es bislang keine Ausbildung gibt, handelt es sich nicht um für den Beruf ausgebildete Fachkräfte. Vielmehr ist der Hintergrund der Kräfte sehr unterschiedlich: Teilweise handelt es sich dabei um junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr. Teilweise sind es aber auch Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem Studium im pädagogischen Bereich. Die Einstellung und Zuteilung erfolgt nicht durch die Schulen, sondern die Schulträger. Wohl nicht zuletzt auch wegen der vergleichsweise schlechten Bezahlung stehen gut ausgebildete Bewerber für die Aufgabe nicht gerade Schlange. Wie engagiert und fachkundig die Unterstützung der Lehrerkräfte ist, ist daher oft Glückssache.
Ein weiteres Problem: Nicht jedes Kind, dass einen Inklusionsbegleiter gebrauchen könnte, hat einen. Einen Antrag auf eine solche Betreuung müssen die Eltern stellen. Manche Erziehungsberechtigte sträuben sich dagegen aus Angst vor Stigmatisierung.
Räume: Anderes Lernen braucht andere Räume
Ob mit oder ohne Inklusion: Die Erkenntnis setzt sich langsam aber sicher durch, dass Lernprozesse genauso individuell sind wie die lernenden Menschen. Insofern ist ein Anspruch an guten Unterricht, dass er differenzierte Lernwege bietet.
In einer Inklusionsklasse stellt sich dieser Anspruch natürlich in besonderem Maße: Die Schüler*innen haben nicht alle das gleiche Lernziel – sie werden zieldifferent gefördert. Das bedeutet zum Beispiel, dass es für die Kinder unterschiedliche Lernmaterialien und eine große Aufgabenvielfalt gibt.
Solche individualisierten Lernsettings erfordern aber auch oft individuelle räumliche Lösungen. Deswegen steht an meiner Schule für die Inklusionsklassen neben dem Klassenraum noch ein weiterer kleiner Raum zur Verfügung – der sogenannte Differenzierungs-Raum. Hier können sich einzelne Lerngruppen oder auch das Lehrer-Team zurückziehen.
Das Problem: Schularchitektur passt nicht zu moderner Didaktik
Die Möglichkeit einen zweiten Raum zu nutzen, ist leider keine Selbstverständlichkeit. Aufgrund steigender Schülerzahlen stoßen viele Schulen ohnehin schon an die Grenzen ihrer Kapazität. Viele Schulen haben daher schlichtweg keine Räume übrig, die genutzt werden können.
Und die vorhandenen Räume im einheitlichen Schuhkarton-Format orientieren sich oft noch an den Erfordernissen einer vergangenen Zeit, in der Unterricht sehr lehrerzentriert war. Die räumlichen Rahmenbedingungen sind daher nicht gut und angesichts des hohen Sanierungsbedarfes ist fraglich, ob hier in absehbarer Zeit Abhilfe geschaffen werden kann.
Inklusion ist so individuell wie die Kinder
Das Ziel von Inklusion an Schulen ist, möglichst niemanden auszuschließen und im gemeinsamen Lernen gesellschaftliche Grenzen abzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Inklusion so individuell gestaltet werden muss, wie die Kinder sind. Während etwa die Leistungen mancher Autisten die der Regelschüler regelmäßig übertreffen, brauchen sie eine besondere sozial-emotionale Begleitung. Bei lernschwachen Schüler*innen ist die Herausforderung, ihnen Aufgaben zu stellen, die sie bewältigen können, ohne sie aus dem Unterrichtssetting der Regelschüler auszuschließen.
Die Voraussetzung für die Inklusion dieser Kinder ist Differenzierung: Eine Methode, die wir wiederholt im Klassenteam eingesetzt haben, ist die Differenzierungs-Matrix, die eine große Aufgabenvielfalt und möglichst passende Herausforderungen für alle Schüler*innen garantiert. Von solchen Unterrichtssettings profitieren letztlich alle Kinder, das sie auch für die ja in ihren Fähigkeiten und Interessen äußerst heterogenen Regelschüler individuellere Zugänge zum Lernen ermöglicht. Insofern Inklusion am Gymnasium zu mehr Differenzierung führt, kann sie einen Beitrag zu einer schülergerechteren Lernkultur für alle leisten.
Das Problem: Inklusion funktioniert (so) nicht für alle
Es gibt allerdings auch Schüler*innen bei denen eine Inklusion an einer Regelschule unter den derzeitigen Bedingungen nur sehr schwer zu realisieren ist. So gibt es zum Beispiel Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf, für die allein schon die Klassengröße ein Problem ist: Für manche, weil sie es unter so vielen Menschen nicht aushalten. Für andere, weil eine so große Ansammlung von Menschen als eine Bühne für aggressives, respektloses oder anstößiges Verhalten dient. Weil Regelschulen mit solchem Verhalten überfordert sind, kann das Ergebnis der Inklusion dann sein, dass diese Schüler*innen einen Großteil des Tages in vollständiger Exklusion lernen.
Der Gedanke liegt nahe, dass für solche Kinder das alte Förderschulsystem mit intensiver Betreuung in kleinen Lerngruppen die bessere Lösung ist. Schulministerin Yvonne Gebauer hat wohl auch deshalb angekündigt, dass zum einen Förderschulen erhalten bleiben und zum anderen in inklusiven Regelschulen Förderschulzweige eingerichtet werden sollen, in denen Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf in Teilen separat unterrichtet werden. Gebauer nennt dies „differenzierte Inklusion“.
Wie genau diese geregelt sein werden, ist noch nicht klar. Die Antwort der Politik scheint aber zu sein, auf die Herausforderungen der Inklusion mit der Rückkehr zur Separation zu reagieren. Die Frage bleibt, wie der Erhalt des Zwei-Säulen-Modells mit Förderschulen und Regelschulen mit dem Grundgedanken der Inklusion und der UN-Behindertenrechtskonvenion vereinbar ist.
Inklusion braucht Soziale Kompetenzen
Wie jede größere Gemeinschaft ist eine Klasse ein hochkomplexes soziales System: Schüler*innen lachen und weinen zusammen, verlieben sich, streiten sich, versöhnen sich, schließen manche ein und andere aus. Und diese Komplexität nimmt natürlich noch einmal zu, wenn Kinder mit Förderbedarf dazu kommen.
Umso wichtiger sind soziale Kompetenzen. In unserem Fall investiert das Klassen-Team und vor allem das Leitungstandem immer wieder viel Zeit: Zusammen mit den Schüler*innen besprechen sie zum Beispiel im Klassentat auftretende Probleme und erarbeiten Regeln für die Klassengemeinschaft. Dabei greifen sie auch auf die Unterstützung der Schulsozialarbeiter zurück, die hier über besonderes Know-How verfügen. Weil wir eine Schule im gebundenen Ganztag sind, verfügen wir hier über einige zusätzliche Ressourcen.
Das Problem: Keine Zeit für Social Learning
Leider verfügen nicht alle Schulen über solche pädagogische Mitarbeiter: Lehrer*innen sind beim Umgang mit Problemen innerhalb der Klassengemeinschaft oft auf sich alleine gestellt. Dabei handelt es sich zudem um eine Aufgabe, die in der Ausbildung wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle spielt. Erschwerend kommt dazu, dass für die Förderung von sozialen Kompetenzen im Schulalltag kaum Zeit und Raum bleibt.
Elternarbeit: Die Erziehungsberechtigten als Team-Mitglieder
Damit Inklusion funktioniert, müssen nicht nur die Schüler*innen alle gleichermaßen in die Klassengemeinschaft investieren. Es hilft, wenn auch Eltern den Prozess wohlwollend begleiten.
Die Kooperation mit den Eltern von Kindern mit Förderbedarf ist für Lehrer*innen immer wieder eine besondere Herausforderung. Dies beginnt schon bei der Diagnose des Förderbedarfs: Damit die Kinder die bestmögliche Förderung erhalten, ist eine möglichst genaue Diagnose erforderlich. Allerdings sperren sich manche Eltern dagegen, dass ihre Kinder getestet werden. Dahinter steht oft ein guter Wille: Sie wollen nicht, dass ihr Kind stigmatisiert wird. So kann es zu Konflikten kommen. Aber auch mit den vielen Eltern von Kindern mit Förderbedarf, mit denen die Kommunikation gut gelingt, ist der Kommunikationsaufwand meist höher als bei Regelschülern.
Aber auch bei Eltern von Regelkindern kann die Elternarbeit in einer Inklusionsklasse anspruchsvoller sein: Viele sehen die Inklusion kritisch und haben häufig die Sorge, dass ihre Kinder zu kurz kommen. Die Elternarbeit ist dadurch insgesamt deutlich intensiver und eine besondere Herausforderung. Aber auch hier gilt wie im Lehrer-Team: Durch die intensivere Zusammenarbeit kann auch ein intensiverer Zusammenhalt zwischen Pädagogen und Erziehungsberechtigten zustande kommen, der das Wohlergehen der Kinder fördert.
Das Problem: Elternarbeit kostet viel Zeit, wird aber nicht entlohnt
Wie beschrieben sind die Anforderungen bei der Elternarbeit für Lehrer*innen in Inklusionsklassen in der Regel höher und somit müssen die Pädagogen hier mehr Zeit investieren. Dieser Anforderung wird aber im Hinblick auf die Arbeitszeit wenig Rechnung getragen.
Die Lehrer-Arbeitszeit richtet sich nach Unterrichtsstunden. An Gymnasien in NRW beträgt die Regelarbeitszeit 25,5 Stunden. Dabei wird kein Unterschied gemacht, ob Lehrer*innen diese in einer Regel- oder einer Inklusionsklasse ableisten. Insofern ist die anspruchsvollere Elternarbeit eine der vielen Aufgaben, die Inklusions-Lehrer*innen leisten müssen, ohne dass dafür in angemessenen Maße zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Not macht erfinderisch: Die Schulleitung verwaltet den Mangel
Es ist ein zentrales Problem, dass von den Landesregierungen nur knappe Ressourcen zur Umsetzung der Inklusion zur Verfügung gestellt werden. Ich habe im Blog schon erläutert, wieso dass dazu führt, dass Schulen große Probleme haben, neue Aufgabe wie die Inklusion oder die Digitalisierung zu bewältigen. Um dennoch ihrer pädagogischen Verantwortung gerecht zu werden, müssen die Schulen tragfähige Lösung finden. Eine geschickte Verwaltung des Mangels ist hier gefragt.
Einige unserer schulinternen Lösungen habe ich bereits beschrieben – etwa feste Zeitfenster für Team-Sitzungen im Stundenplan oder ein eigener Differenzierungs-Raum. Möglich machen kann solche Privilegien nur die Schulleitung. Umso wichtiger ist es, dass die Führungskräfte die besonderen Bedürfnisse der Inklusionsklassen ernst nehmen und die Lehrkräfte so weit wie möglich unterstützen.. Dafür ist es unerlässlich, dass sich die Mitglieder der Schulleitung selbst intensiv mit dem Thema Inklusion und den daraus erwachsenden Anforderungen auseinander setzen.
Das Problem: Lücken in der Leitung führen zu Lücken im Konzept
Die Realität ist, dass bei weitem nicht alle Schulleiter*innen dem Thema Inklusion offen gegenüberstehen. So reichte kürzlich erst die Schulleiterin eines Bremer Gymnasiums Klage gegen die Einrichtung einer Inklusionsklasse ein. Dies muss nicht an einer grundsätzlichen pädagogischen Ablehnung liegen. Für viele Schulleiter*innen ist die Inklusion ein weiteres Feld, auf dem sie den akuten Ressourcen- und Personal-Mangel verwalten müssen.
Dabei sind Schulleiter*innen oft ohnehin schon im normalen Schulalltag überfordert: So kam etwa kürzlich ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Alexander Thiele von der Uni Göttingen zu dem Schluss, dass die Arbeitszeiten hessischer Schuldirektoren von regelmäßig 50 bis 60 Stunden pro Woche gegen das Grundgesetz und bestehende landesgesetzliche Regelungen verstoßen.
Diese Überlastung ist sicherlich ein Grund dafür, dass viele Schulen derzeit gar keinen Schulleiter haben. Betroffen davon sind vor allem Grund-, Haupt- und Realschulen. Dieses Führungs-Vakuum fällt bei organisatorisch anspruchsvollen Aufgaben wie der Realisierung von tragfähigen Strukturen für Inklusion besonders ins Gewicht.
Fazit: Inklusion kann gelingen – wenn die Bedingungen stimmen
Inklusion ist aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht eine Chance – auch und gerade an Gymnasien. Richtig umgesetzt, fördert sie differenziertes Lernen, stärkt soziale Kompetenzen, reduziert soziale Barrieren und ist Treibstoff für Team-Work in den Lehrerzimmern. Mein positiver Blick auf die Inklusion rührt aber auch daher, dass ich in meinem Team unter nahezu optimalen Bedingungen arbeiten kann, die leider die Ausnahme und nicht die Regel sind.
Viele Lehrer*innen können von diesen idealen Bedingungen nur träumen: So erleben viele Lehrer*innen die Inklusion als Herausforderung, die sie nicht meistern können, selbst wenn sie guten Willens sind. Das führt zu Frust und darunter leidet die Akzeptanz der Inklusion in den Kollegien.
Ich habe wie oben beschrieben in vielerlei Hinsicht Glück gehabt. Deswegen erlebe ich die Inklusion als eine Bereicherung meines Berufsleben. Es darf aber nicht von glücklichen Fügungen abhängen, ob Lehrer*innen in Inklusions-Klassen gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Die Gesellschaft hat Lehrer*innen den Auftrag gegeben, die Inklusion im Schulsystem zu organisieren. Es ist die Aufgabe der Politiker*innen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Pädagog*innen diesen Auftrag auch erfüllen können.
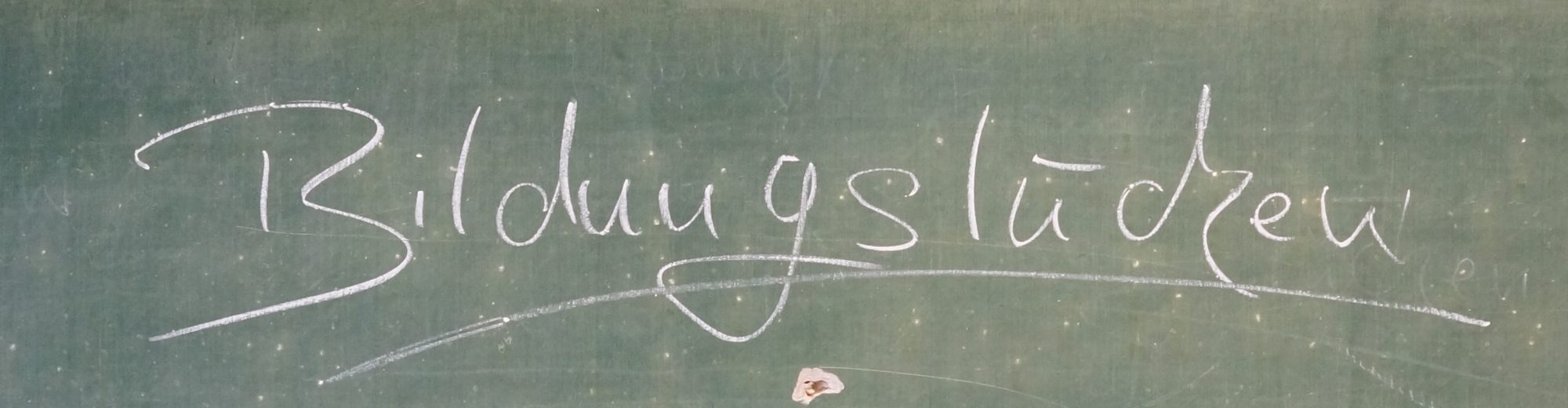

Hallo,
es ist greulich, wie sich die Situation mittlerweile darstellt. „Grillt“ die verantwortlichen Politiker, denn anders kommen wir da nicht mehr heraus! Es ist doch sehr widersprüchlich bis pervers, wenn sich Gymnasien mit derart schwierigen Integrationsproblemen herumschlagen müssen. Solange diese noch „toleriert oder gewünscht“ sind, sinkt dadurch das Niveau. Sehr aussagekräftig, wer gerade als Elternschaft an der Existenz der höheren Schule Gymnasium festhält, aber politisch dieselbe aushungert. Meine Erfahrungen aus ISS und Sekundarschulen zeigt auch hier den Notfallmodus. Beispiel: die politisch verbrämte äußere Differenzierung wird als völlig neue Idee aufgewärmt und so Differenzierungskurse zur „Entsorgung“ schwierigster Schüler gebildet. Funktioniert nicht wirklich.
Ich glaube, dass wir um eine letztendliche klare Positionierung nicht umhin kommen – und wenn eine größere politische Aktion dazu nötig ist!
I-Klassen im Gymnasium sind doch ein schlechter Scherz (der Geschichte), wenn ich den Grundgedanken des Gymnasium, eben auch des gegliederten Schulsystems bedenke. Da helfen auch Teams und Doppelbelegung nicht, denn diese müssen immer funktionieren. Aber naturgemäß kann ich nicht mit jedem willkürlich mit mir gemeinsam eingeteiltem Kollegen gut zusammenarbeiten, was den erzielten Effekt wieder tief hinab reißt. Es haben vor mir damals „jungen“ Kollegen schon alte Hasen geschwitzt – aus meiner Sicht grundlos, aber eben reine Psychologie, wenn man nicht ganz pädagogisch/politisch einig ist und persönlich nicht ausreichend vertraut.
Daher nochmals die Meinung: Es muss nun nach der Regierungsbildung endlich ohne Bildungsförderalismus eine klare vorerst endgültige Entscheidung getroffen werden: gegliedertes Schulsystem oder Einheitsschule (ohne Gymnasium!). Und dann konsequente Durchsetzung. Ohne Schummelei und Hintertüren. Dann würde auch ich als konservativer Geist eine Gemeinschaftsschule unterstützen, bis die aus meiner Sicht unvermeidlichen Widersprüche offen sind. Oder aber ehrlich die qualitativ guten Schulformen des gegliederten Schulsystems stärken und wiederbeleben. Inklusion auf Wunsch punktuell und nur bei konsequenter sicherer finanzieller und pädagogischer Begleitung. ansonsten weiter die starken Förderschulen anbieten.
Pingback: Inklusion am Gymnasium – so kann sie gelingen | Kleinerdrei
Pingback: Inklusion am Gymnasium – so kann sie gelingen (Teil 2) | Kleinerdrei
Hallo,
ich habe im laufe meines Lebens selbst zweimal versucht als schwerbehinderter Mensch mich in eine reguläre Schule einzubringen.
Fazit: Inklusion ist Mist und funktionier einfach nicht.
Das ist natürlich zu bedauern. Allerdings kann man wohl kaum aus dem Einzelfall darauf schließen, dass Inklusion grundsätzlich schlecht ist.
Ich habe mich ja bemüht, Rahmenbedingungen zu beschreiben, die erforderlich sind, um eine erfolgreiche Inklusion im Schulsystem zu erreichen. Das Problem ist, dass diese in den wenigsten Schulen gegeben sind.
Ihre Darstellung einer gutfunktionierenden Inklusion ist wirklich ein Einzelfall! Es ist reine Glücksache, das die Strukturen ihre Inklusionsklasse bestehend aus Doppelsteckung, Sonderpädagogen, Inklusionshelfer = Schulassistenzen (fitten Hausmütterchen), tollen Räumlichkeiten, Zeitfenster für Teamabsprachen, Kooperationsvoraussetzungen mit Vertrauensbasis, Kommunikationsbereitschaft, Gleichberechtigung und keinerlei Konkurrenzgebaren etc. Ich freue mich für Sie, das sie diese vorzügliche Erfahrung in ihrem Berufsleben machen könnten. Aber leider sieht die Welt da draußen ganz anders aus! Diese ist für eine gesellschaftliche Inklusion noch lange nicht in der Lage, wie wir das gerade derzeitig durch Erhöhung einer gesellschaftlichen Heterogenität verschiedener Nationalitäten gut beobachten können. Unter den flüchtenden Menschen sind die wenigsten noch nicht einmal behindert. Sie sind ganz normal, so wie du und ich. Gerade unter Lehren gibt es viele schwarze Schafe, die große Unterschiede machen, dichotome Sichtweise verfolgen unter ihren Nichtbehinderten Schülern. Vorzüge den wenigen, bessergestellten bereithalten. Kollegiumstöchterchen bevorzugen usf.
Die Lehrerschaft ist ja selbst sehr heterogen. Nicht wenige werden gezwungen Inklusionsklassen zu übernehmen. Nicht wenige leiden auch unter Profilierungssucht. Und das Gegenteil ihrer Strukturbedingungen ist damit das realistische Ergebnis. Ich bin Förderschullehrerin, arbeite in der Inklusion und könnte kot………………
Leider ist es auch meiner Wahrnehmunng nach so, wie sie sagen: Die Bedingungen sind in der Realität an sehr vielen Schulen nicht annähernd so, wie sie sein müssten. Deshalb gelingt die Inklusion oft nicht und gerät so teilweise auch in Verruf. Das liegt daran, dass wegen der schlechten Arbeitsbedingungen bei allen Beteiligten wie bei ihnen großer Frust entsteht.
Mir war es aber ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass Inklusion durchaus funktionieren kann und dann ein großer Gewinn für die Gesellschaft wäre. Dazu müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen!
Die Aufgabe der Gymnasien ist es Kinder mit überdurchschnittlichem Potential auszubilden, so dass sich dieses Entfalten kann und Deutschland als Wissenschafts-, Kultur-, und vor allem Wirtschaftsstandort von Bedeutung bleibt. Es ist keine reine Wohlfahrtsinstitution.
Übers Knie gebrochene Inklusion und Integration passt dort überhaupt nicht hin, es sei denn in sehr milden Fällen. Vor allem nicht wenn dadurch auch nur ein Deut an Lernqualität für die klassischen Gymnasialschüler geopfert wird.
Mal ganz davon abgesehen, dass es in vielen Fällen grausam ist Kindern mit besonderen Bedürfnissen (hoffe das war politisch korrekt formuliert) jeden Tag beneidenswerte Normalität vorzusetzen, so dass sie sich besonders schlecht fühlen.
Sowas kann vielleicht in einer Waldorfschule funktionieren wo es ein spezielles Lernkonzept, Umfeld und ausreichend viel für diesen Job qualifizierteLehrer gibt, aber niemals in einer staatlichen Schule.
Tut mir Leid, aber ich werde unterfinanzierte Inklusion und übertriebene Integration (z.B. mehr als 1-2 muslimischstämmige schwer integrierbare Kinder (danke Elternhaus) je Klasse, sonst wird es schnell zu desintegration der Andern) immer nur als gefährliches Experiment mit unseren Kindern und dem Standort Deutschland ansehen können. Und das nur damit sich einige Gutmenschen politisch profilieren können.
Bitte lasst das! Alle Beteidigten leiden darunter! Lehrer, Schüler, Inkludierte, versuchsweise zu Integrierende und unser Land.
Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen!
Wie ich versucht habe im Artikel zu zeigen, kann Inklusion auch an staatlichen Gymnasien gelingen, wenn sie entsprechend mit den beschriebenen Ressourcen ausgestattet sind. Und meiner Erfahrung nach leiden dann nicht alle, sondern profitieren alle davon – ausdrücklich auch die kognitiv besonders begabten Kinder.