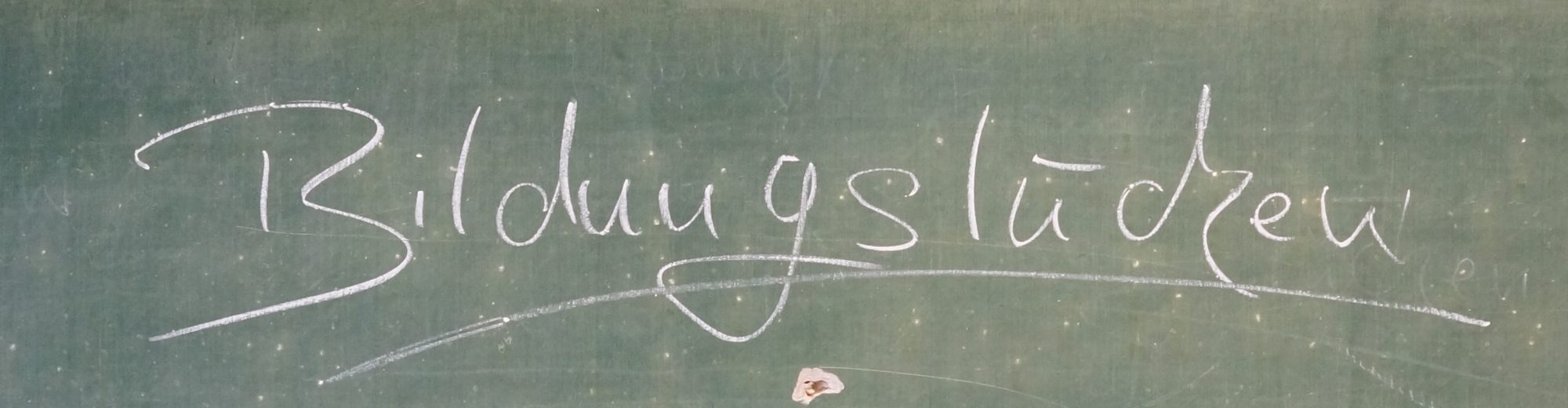Das Bildungsministerium in NRW will mit einem neuen Beteiligungsprogramm die Partizipation von Schüler*innen fördern. An dem Vorhaben lässt sich exemplarisch sehr gut ein grundlegendes Problem der Schulpolitik verdeutlichen: Statt das Schulsystem grundsätzlich zu reformieren, bleibt es bei Programm-Stückwerk.
Überall in Deutschland gehen Tausende Menschen für die Demokratie auf die Straße. Angesichts des Erstarken des Extremismus im Lande, wird vielleicht auch deshalb in vielen Sonntagsreden gefordert, dass an Schulen die Demokratiebildung gefördert werden soll. Dass hier große Defizite bestehen habe ich schon vor Jahren hier im Blog beschrieben.
Es ist löblich, dass nun auch Politiker angesichts der steigenden Unterstützung extremistischer Postionen verstanden haben, dass Demokratiebildung in den Schulen wichtig ist. So kündigte zu Beginn des Jahres auch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Initiative zur Stärkung der Schülerbeteiligung und Demokratiebildung an.
Ob das Programm wirklich einen Fortschritt für die Partizipation bedeutet, ist mehr als fragwürdig. Im folgenden Text möchte ich analysieren, warum es sich hier eher um Aktionismus handelt und wieso dieses Programm damit exemplarisch für eine grundlegende Fehlentwicklung in der Schulpolitik steht.
Es muss ein Programm geben. Schnell!
Anlass für Programme im Bildungsbereich ist meist, dass es ein akutes Problem in den Fokus der Öffentlichkeit schafft. Denn die Liste der Missstände im Schulsystem ist lang; kritische Fragen werden Ministerinnen aber in der Regel nur zu den Problemen gestellt, die gerade besondere Aufmerksamkeit genießen.
Umso wichtiger ist es für Politiker*innen, dass sie in Interviews auf eigenen Aktivitäten verweisen können. Bei Fragen zur Demokratiebildung kam die Landesregierung in NRW zuletzt zuletzt in Erklärungsnot: So gab es im November Medien-Berichte über Pläne der Landesregierung in NRW, Mittel für die Landeszentrale für politische Bildung zu kürzen. Insofern kommt es dem Bildungs-Ministerium sicherlich nicht ungelegen, dass es nun auf dem Feld der Demokratiebildung mit dem Beteiligungsprogramm eine eigene Initiative präsentieren kann.
Immer dann, wenn akute Missstände deutlich werden, zeigen Ministerien ungeahnte Schnelligkeit beim Auflegen neuer Programme. So legte die Landesregierung als Reaktion auf die schlechten IQB-Ergebnisse in Windeseile ein Programm zur Leseförderung auf. Leider scheint bei neuen Programmen oft Schnelligkeit und Quantität systematisch wichtiger zu sein scheint als Qualität. Denn es geht vornehmlich um den Nachweis, dass man das Problem erkannt hat und etwas tut.
Ob das Geld sinnvoll investiert wird, ist dabei nachrangig – auch weil die effektive Verwendung der Mittel im Bildungsbereich schwer prüfbar ist. Es ist leicht für den Bund der Steuerzahler aufzuzeigen, dass Aussichtstürme, von denen man keine besondere Aussicht hat, eine sinnlose Investition sind. Aber wie will irgendwer nachweisen, dass die Investitionen in Demokratiebildung ineffizient sind? Dafür wäre eine echte wissenschaftliche Begleitung erforderlich, die nur in den seltensten Fällen erfolgt.
Suche Dir einen externen Partner / Berater!
Gerade weil es schnell gehen muss, suchen sich die Ministerien für ihre Programme gerne externe Partner. Weil Kooperationen mit Unternehmen im Bildungsbereich fragwürdig erscheinen, sind Stiftungen sehr beliebt – etwa die Bertelsmann-Stiftung, die Telekom-Stiftung, die Vodafone-Stiftung oder die Robert-Bosch-Stiftung.
Im Falle des Partizipationsprogramms kooperiert das Minfsterium mit der Deutschen Kinder und Jugendstiftung (DKJS). Grundsätzlich ist es sicherlich nicht verwerflich, sich durch Kooperationen externe Ressourcen einzuholen. Für die Ministerien bedeutet das vor allem aber auch: Sie müssen keine zusätzlichen Stellen schaffen, um ein Problem anzugehen. Es genügt hier eine einmalige Summe an Haushaltsmitteln bereitzustellen. Und wenn ein Programm scheitert, können die Politiker leicht die Schuld auf die Partner schieben.
Die ständige Anbindung an Berater und Stiftungen ist jedoch auf lange Sicht aber kontraproduktiv: Denn in den Ministerien und Behörden entstehen keine eigenen belastbaren Strukturen und keine eigene Expertise. Und ob Stiftungen, die den Namen von Großkonzernen im Namen tragen wirklich nur im Sinne der Allgemeinheit handeln, ist zumindest fragwürdig.
Mache die Teilnahme freiwillig!
In der Öffentlichkeit wird immer mal wieder öffentlich darüber gestritten, ob eine vermeintliche Innovationsfeindlichkeit von Lehrkräften Teil des Problems des Schulsystems ist. Klar ist: Die Berufsverbände der Lehrkräfte – etwa die GEW oder der Philologenverbande – stehen so mancher Veränderung kritisch gegenüber. Das hat aber auch damit zu tun, dass an Schulen neue Aufgaben in der Regel nicht gleichzeitig mit neuen Ressourcen verbunden werden.
Wohl auch deswegen betont Ministerin Feller in der Pressemitteilung: „Wir wollen nichts verordnen oder überstülpen, wir nehmen die Schülerinnen und Schüler ernst und bauen alles Weitere auf ihren Gedanken und Wünschen auf.“
Weil die Teilnahme an neuen Programm aber oft freiwillig ist, habe Ministerien keine Kritik zu befürchten. Zudem entzieht sich das Ministerium aber automatisch der Verantwortung die beteiligten Lehrkräfte irgendwie zu entlasten: Diese begleiten die Schüler*innen auf eigene Rechnung. Damit hängt die Teilnahme aber wie so oft im Schulwesen am Engagement einzelner Schulleitungen und Lehrkräfte, die zunächst von der Ausschreibung erfahren und sich dann bewerben müssen.
Daraus folgt auch, dass sich wahrscheinlich vor allem Schulen beteiligen werden, die personell gut ausgestattet sind. Denn neue Projekte können sich Lehrkräfte nur dann aufhalsen, wenn Sie im normalen Alltag nicht schon komplett überlastet sind, weil die Schule unter Lehrkräftemangel leidet. Programme können daher im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass die ohnehin große Schere zwischen Schulen noch weiter aufgeht.
Schaffe „Leuchttürme“!
In der Regel können aber ohnehin nicht alle Schulen an solchen Initiativen teilnehmen, weil dafür nicht genügend Menschen und Geld vorhanden ist. So können am Beteiligungsprogramm in NRW in der ersten Stufe nur 250 Schulen und in einer zweiten Stufe gerade einmal 25 Schulen teilnehmen. Bei insgesamt mehr als 5000 Schulen in NRW kann das Programm daher schlichtweg keine nachhaltige Wirkung in der Breite entfalten.
Aus der Not lässt sich aber kommunikativ leicht eine Tugend machen. Denn die Schulen, die an solchen Programmen teilnehmen, sind dann eben „Leuchttürme“. Verbunden damit ist die Hoffnung, dass die Impulse sich wie durch Geisterhand auch auf andere Schulen verteilen.
Allerdings ist fragwürdig, ob solche Leuchttürme überhaupt einen Effekt auf das ganze Schulsystem ausüben. So erhalten seit 2006 besonders innovative Schulen den Deutschen Schulpreis. Doch obwohl deren Konzepte öffentlichkeitswirksam ins Schaufenster gestellt werden, hat sich seitdem wenig in den meisten Schulen geändert. Dafür müssten sich die Schulpolitiker eben auch an grundlegende Reformen des Schulsystems wagen.

Vermeide eine Veränderung vorhandener Strukturen!
Auch das Beteiligungsprogramm ändert nichts an den vorhandenen Strukturen. Es sollen stattdessen „neue Beteiligungsformate“ geschaffen werden. Das ist in diesem konkreten Fall allerdings eher fragwürdig. Denn eigentlich braucht es gar keine neuen Strukturen, weil das Land in NRW die Partizipation vorbildlich fest im Schulgesetz festgeschrieben hat: Mit Klassenräten, Schülerräten oder den Bezirksschülervertretungen gibt es gesetzlich und demokratisch legitimierte Gremien. Und die Schüler*innen-Vertretungen (SV) haben in NRW sehr weitreichende Rechte und können so auch ohne Segen der Ministerin ein Motor für die Schulentwicklung sein.
Umso verwunderlicher ist es daher, dass die SV in den Plänen des Ministeriums keine tragende Rolle zu spielen zu scheint. Statt die bestehenden, gesetzlich festgeschriebenen Strukturen zu stärken, sollen neue Formate geschaffen werden. Und obwohl dem Ministerium die Beteiligung vorgeblich so wichtig ist, wurden die existierenden Schüler-Vertretungen offenbar bei der Planung gar nicht ins Boot geholt. Zwar saßen zwei offenbar mehr oder weniger willkürlich ausgewählte Schüler*innen bei der Präsentation auf dem Podium. Laut der Pressemitteilung sollen aber „wichtige Akteure des Schullebens und der Jugendbeteiligung wie etwa die Landesschülervertretung und der Landesjugendring“ erst im Nachhinein eingebunden werden.
Frage nicht die Betroffenen, was ihre Bedürfnisse sind!
Hätte man die Landesschülervertretung vorab gefragt, was sie von den Plänen hält, hätte sie der Ministerin womöglich zurückgemeldet, dass das Programm an den eigentlichen Problemen der Schülervertretungen vorbei geht. Über die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche SV-Arbeit an den Schulen habe ich auf der Basis meiner Erfahrungen als Verbindungslehrer im Blog schon geschrieben.
Es gibt eine Menge von konkreten Maßnahmen, die der Partizipation an allen Schulen schnell auf die Sprünge helfen könnten: die Schaffung von (Zeit-)Räumen für die verbindliche Durchführung von Klassenräten, eigene Budgets für die SVen, gezielte und bessere Ausbildung der Verbindungslehrkräfte, eine bessere finanzielle und personelle Unterstützung der Bezirks- und Landesschülervertretungen und vieles mehr.
Es zeigt sich hier ein zentrales Problem vieler Programme im Bildungsbereich: Sie werden in Amtsstuben erdacht ohne ernsthafte Konsultation der Betroffenen. Wünschenswert wäre aber eine nutzerorientierte Gestaltung, die auf einer Analyse der Bedürfnisse der Betroffenen basiert – so wie es etwa in der Software-Branche längst zum Standard geworden ist.
Setze Dir keine konkreten überprüfbaren Ziele!
Zum ABC bei der Projektplanung gehört eigentlich auch, dass man sich als Grundlage konkrete und Ziele setzt, bei denen sich am Ende des Projektes prüfen lässt, ob sie erreicht wurden. Gerade im Bildungsbereich erfolgt das aber so gut wie nicht. Das gilt offenbar auch für das neue Beteiligungsprogramm. Hier geht es laut der Präsentation um einen „ergebnisoffen Prozess“.
Man könnte das schlechtes Projektmanagement nennen. Oder man verkauft es eben als die entscheidende Qualität des Programms. So sagt Ministerin Feller laut Pressemitteilung: „Dabei legen wir großen Wert darauf, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Wege gehen können. Wir geben keine Themen und Formate vor, sondern setzen auf einen Prozess von unten. Das Signal lautet: Wir hören Euch und wir nehmen Euch ernst!“
Setze eine Auslaufdatum!
Programme ohne echte Beteiligung der Betroffenen und Veränderung des Systems haben einen entscheidenden Vorteil: Solange die öffentliche Aufmerksamkeit auf ein Problem blickt, kann man darauf verweisen. Und wenn andere Themen in den Fokus rücken, kann man die Programme einfach auslaufen lassen. Weil ja keine Stellen oder bleibende Strukturen geschaffen worden sind, ist dann auch direkt wieder Geld für das nächste Programm da.
So soll das Programm für neue Beteiligungsformate nur bis 2026 laufen. Was danach passiert? Darüber gibt es keine Auskunft. Womöglich muss sich die Ministerin aber auch gar keine Gedanken darüber machen: Schließlich wird ja 2027 der Landtag in NRW neu gewählt.
Aufgrund der regelmäßigen Wechsel in der Verantwortung der zuständigen Kultusministerien ist es bei Programmen nur vernünftig, sich nicht über die eigene Legislaturperiode hinaus festzulegen. Wieso sollte man viel Geld und politisches Kapital in eine langfristig wirkende Maßnahme investieren, von der womöglich nur der eigene Nachfolger profitiert?
Nutze eine digitales Tool!
Diese politische Kurzatmigkeit ist ein zentrales Problem des Schulsystems: Weil echte Veränderungen viel Zeit brauchen und oft Widerstand hervorrufen, lohnt es sich politisch nicht, hier finanzielles und politisches Kapital zu investieren. Dies ist auch im Bereich der Digitalisierung spürbar. So sind etwa diverse Landesregierungen in NRW bislang daran gescheitert den Schulen unter dem Namen Logineo eine funktionierende Digital-Plattform zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht auch um das zu verschleiern, vergeht kaum ein Monat, in dem den Schulen nicht irgendein neues digitales Tool zur Verfügung gestellt wird. Ein immer noch beliebter Running Gag in den Lehrerzimmern in NRW ist die Tatsache, dass das Land NRW 2021 1,6 Millionen für eine Dreijahres-Lizenz für den digitalen Brockhaus ausgab.
Überraschenderweise kommt das neue Beteiligungsprogramm des MSB bislang ohne digitalen Kniff aus. Aber auch das ist irgendwie bezeichnend. Denn tatsächlich gibt es mit Aula bereits eine Plattform, die eigentlich ideal dafür geeignet wäre, neue Beteiligungsformate zu unterstützen. Die Open-Source-Software wurde eigens dafür entwickelt, um Partizipationsprozesse an Schulen zu erleichtern.
Die bekannte Politikerin und Publizistin Marina Weisband setzt sich seit Jahren für die Verbreitung dieser sinnvollen Software ein. Trotz dieser prominenten Fürsprecherin und erfolgreicher Anwendung in vielen Schulen muss sich das Projekt immer wieder um neue Partner für die Finanzierung bemühen.
Fazit: Programm-Taktik statt Bildungs-Strategie
Aus dem militärischen Bereich stammt die Unterscheidung zwischen Strategie und Taktik. Während die Taktik eher auf das kurzfristige Handeln ausgerichtet ist, umfasst eine Strategie einen längerfristigen Plan. Eine gute Taktik ist vor allem dann erforderlich, wenn man kurzfristig flexibel auf die Umstände reagieren will. Strategie ist ist jedoch die Grundlage für langfristigen Erfolg.
Programme wie das Beteiligungsprogramm haben in der Schulpolitik rein taktischen Charakter. Sie reagieren nicht selten auf aktuelle Missstände. Das ist für sich genommen nicht falsch. Das Problem ist aber, dass sie eben nicht Teil einer langfristigen Strategie sind. Insofern können sie bestenfalls die Symptome etwas lindern, aber Probleme nicht lösen.
Das Problem scheint dabei zu sein, dass Politikern eine grundlegende Strategie für eine zeitgemäße Reform des Schulsystems grundsätzlich fehlt. Es ist kein Zufall, dass die NRW-Ministerin Feller direkt zu Beginn die Wahrung des Schulfriedens als Ziel betonte und Veränderungen von Schulstrukturen eine Absage erteilte. Auch andere Schulpolitiker aus anderen Parteien wagen sich kaum noch an Grundsatzdiskussionen heran.
Die vielen Programme operieren daher notgedrungen immer in der Logik des vorhandenen Systems. Dabei liegt allen Überlegungen immer ein jahrzehntealtes Paradigma von Schule zugrunde, das Reformen verhindert. Insofern sind Programme wie das Programm für mehr Beteiligung an Schulen oft nicht nur wirkungslos, sie tragen sogar oft dazu bei, bestehende Missstände zu kaschieren – und die Probleme im Schulsysteme damit auf Dauer eher noch zu verschlimmern.