Die Corona-Pandemie hat viele Schwächen des deutschen Schulsystems gnadenlos offengelegt. Dennoch halten Schulpolitiker am Status Quo fest: Schule soll möglichst schnell wieder so sein, wie sie seit Jahrzehnten ist. Es zeigt sich erneut: Veraltete Vorstellungen von einer guten Schule prägen die öffentlichen Diskurse und verhindern echte Reformen.
In meinem Referendariat schauten wir den 2004 erschienene Dokumentarfilm „Treibhäuser der Zukunft“ von Reinhard Kahl. Ich kann mich daran erinnern, wie beeindruckt ich war von den Einblicken in reformorientierte Schulen: Die Schüler*innen lernten so anders, als ich es aus meiner eigenen Schulzeit kannte. Nach dem Pisa-Schock lag auch ein gewisser Innovationswille in der Luft – ich hatte Hoffnung, dass Schulen sich tatsächlich verändern würden.
Mehr als ein Jahrzehnt später muss ich konstatieren: Seit dem Erscheinen des Films hat sich das deutsche Schulsystem so gut wie nicht weiter entwickelt. Auch die Corona-Pandemie, die die Schwächen unseres Schulsystems erbarmungslos aufgezeigt hat, scheint daran nichts geändert zu haben. Im Frühjahr hatte ich einen Blog-Artikel beschrieben, welche Lehren im Hinblick auf das Schulsystem aus der Corona-Pandemie gezogen werden könnten. Doch das scheinbar einzige Ziel der Schulpolitik scheint weiterhin die Rückkehr zum althergebrachten Präsenzunterricht zu sein.
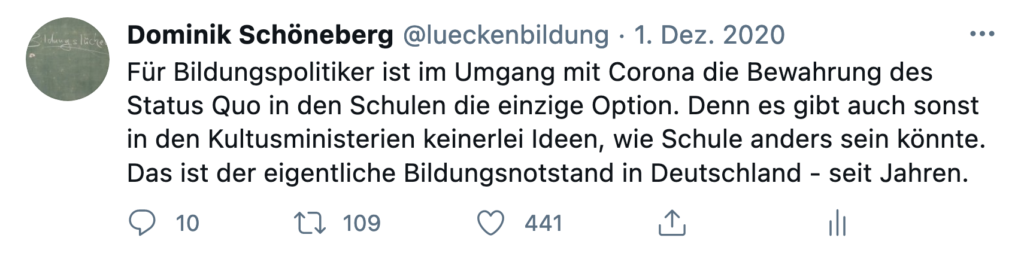
Dabei würde kaum jemand ernsthaft behaupten, dass unser Schulsystem sonderlich gut ist. Im Gegenteil: Vergleichende Studien zeigen immer wieder aufs neue, dass Schüler*innen in deutschen Schulen durchschnittlich weniger lernen als in anderen Ländern. Und viele Schüler*innen verbinden ihre Schulzeit eher mit Langeweile oder Leistungsdruck als mit spannenden Lernerfahrungen. Wieso gibt es dennoch so wenig Innovation im deutschen Bildungssystem? Wieso gibt es gegen Reformen so oft sogar Widerstände bei Politiker*innen, Eltern und Lehrkräften?
Ein zentraler Punkt ist aus meiner Sicht, dass eine Abkehr vom traditionellen Schulsystem einen echten Paradigmenwechsel erfordern würde. Solche Revolutionen erfolgen aber niemals ohne Gegenwind: Thomas S. Kuhn hat im Hinblick auf den wissenschaftlichen Fortschritt aufgezeigt, wie herrschende Vorstellungen den Fortschritt behindern können. Kuhn beschreibt dies unter anderem anhand des jahrhundertelange Festhalten am geozentrischen Weltbild, obwohl wissenschaftlich längst bewiesen war, dass die Erde um die Sonne kreist. Doch die Vertreter des alten Paradigmas verteidigten es mit Zähnen und Klauen.
Vergleichbares lässt sich auch im Schulwesen diagnostizieren: Egal ob bei Digitalisierung, Inklusion oder der Abschaffung des gegliederten Schulsystems – stets beharren treibende Kräfte auf dem Status Quo – unabhängig davon, ob es hinreichend Belege oder Argumente dafür gibt, ihn beizubehalten.
Axel Krommer analysiert diese Verteidigung althergebrachter Paradigmen im Schulwesen schon länger – sein Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf dem Gebiet der Digitalisierung und dem Einsatz neuer Medien. Eine besonders pointierte Darstellung der Mechanismen, die das alte Schulsystem bewahren, ist Krommer bei seiner Keynote beim Aachener Didaktiktag im Hinblick auf die Digitalisierung gelungen:
Ich möchte anknüpfend an Krommers Überlegungen zu vorherrschenden Paradigmen im Schulsystem im folgenden Artikel analysieren, welche traditionellen Setzungen das Bild von Schule und dadurch auch die Schulpolitik heute dominieren. Im Anschluss will ich jeweils zeigen, inwiefern diese Facetten des vorherrschenden Paradigmas Innovationen verhindern.
Folgende wirkungsmächtigen Wahrheiten möchte ich dabei untersuchen:
- Lernen erfolgt im von Lehrer*innen gesteuerten Unterricht!
- Unterricht findet in Präsenz im Klassenraum statt!
- Der Unterricht erfolgt in festgelegten Fächern!
- Lernen erfolgt in einem festen Stundenplan!
- Schüler*innen lernen in einer Klasse mit Kindern ihres Jahrgangs!
- Leistungen werden mit Noten bewertet!
- Leistungskontrollen erfolgen durch schriftliche Prüfungen!
Lernen erfolgt im von Lehrer*innen gesteuerten Unterricht!
Was die Vorstellung ist:
Ein Wunsch vieler Eltern während der Corona-Pandemie war der nach „echtem“ Unterricht per Videokonferenz: Mit Unterricht war hier ein lehrerzentrierte Prozess gemeint, bei dem eine Lehrkraft klare Strukturen vorgibt, einen Wissenstransfer organisiert und den Lernprozess jederzeit beaufsichtigt und kontrolliert.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Die skizzierte Vorstellung von „Unterricht“ entspricht eher einem Lehr- als einem Lernprozess. Lernen ist ein individueller Prozess, der bei jedem Mensch anders abläuft. Die Vorstellung, dass ein Lehrer ein für alle Schüler*innen passendes Lernangebot machen kann, ist angesichts der Vielfalt in den Klassenzimmern absurd.
Das vorherrschende Paradigma hat meiner Beobachtung nach auch Auswirkungen auf die Psyche der Schüler*innen: Vielfach erlebe ich Schüler*innen, denen es lieber ist, wenn ich als Lehrer für sie entscheide: Sie haben sich daran gewöhnt, keine Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. In einer Gesellschaft, in der Autonomie aber das zentrale Lernziel ist, ist diese Diagnose ein Ausweis des Scheiterns.
Zudem werden Zeiten, in denen Schüler*innen selbständig arbeiten und lernen durch diese Sichtweise herabgewürdigt. Dabei ist es doch gerade die Kompetenz zum selbständigen Lernen, die sie für ihr späteres Leben, im Studium oder im Beruf brauchen. Die nötigen Fähigkeiten erwerben die jungen Menschen nur durch Übung – von Lehrer*innen gesteuerte Lernprozesse sind hier eher kontraproduktiv. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Lehrkräfe ihre Schüler*innen alleine lassen, sondern sie unterstützen sie beim Erwerb der nötigen Kompetenzen und sorgen für eine lernförderliche Atmosphäre und anregende Anstöße und Impulse.
Dass Schüler*innen selbstständig arbeiten, bedeutet auch ausdrücklich nicht, dass das Lernen unorganisiert ist. Lernsettings, die individuelle Lernwege ermöglichen, sind oft organisatorisch viel aufwendiger. Meiner Erfahrung nach gilt: Je größer der Grad der Freiheit ist, desto wichtiger sind organisatorische Leitplanken, die zu einer effizienten Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schüler*innen führen.
Konzepte für die Organisation von selbständigem Lernen gibt es viele: Offene Lernzeiten, in den Schüler*innen autonom arbeiten. Projektzeiten, in denen sie eigene Ziele verfolgen. Hybridlernen, in dem sie einen Teil des Lernens zu Hause erledigen.
Davon abgesehen wird der Lernerfolg im Unterricht ohnehin überschätzt. Meiner Erfahrung nach sind Erlebnisse, die Schüler*innen an den Schulen außerhalb des Unterrichtes sammeln, oft viel prägender: Der Auftritt bei einer Theater-Aufführung, die Gemeinschaft in der Schülerband, das Engagement in der Schülervertretung. Dass in den letzten Jahren aber die Spielräume für die außerunterrichtlichen Angebote eher zurückgegangen sind, wird leider kaum thematisiert.
Unterricht findet in Präsenz im Klassenraum statt!
Was die Vorstellung ist:
In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt: Der Präsenzunterricht ist nicht nur für viele Bildungspolitiker das Maß der Dinge. Unterricht wird gleich gesetzt mit der Präsenz von Lehrkräften und Schüler*innen in der Schule – am besten sogar in einem Raum. Nur unter der Anleitung und Aufsicht von Lehrkräften können Schüler*innen erfolgreich lernen.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Was die Corona-Pandemie auch gezeigt hat: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Schüler*innen auch ohne Präsenz lernen können. Ein Beispiel ist etwa das Flipped-Classroom-Modell, dass sich auch im Distanzunterricht gut setzen ließ. Aber auch die durch die Digitalisierung vielfältiger gewordenen Möglichkeiten des kooperativen Lernens funktionieren von zu Hause aus mindestens genau so gut.

Zudem gibt es viele Aufgaben, die Schüler*innen besser zu Hause erledigen können: So kann man etwa einen philosophischen Essay oder ein Kunstwerk oft in der Abgeschiedenheit und Ruhe viel besser gestalten, als in einem wuseligen Klassenraum.
Auch Projektunterricht, bei dem die Schüler*innen den Klassenraum und die Schule verlassen, ist unter der Vorgabe der Präsenz aufwändiger zu organisieren: Ein Lehrer, der seine Schüler in die Welt schickt, macht sich derzeit angreifbar. Dabei ist der Wert von außerschulischen Lernorten groß: Sie erlauben die Einbindung des Lernens in die Gemeinde, in die Wirtschaft, das soziale Gefüge.
Am Paradigma des Präsenzunterrichts im Klassenraum orientieren sich auch die Schulgebäude. Selbst viele Neubauten sehen immer noch genauso aus, wie Schulen immer schon aussahen: Lange Flure, Räume im Schuhkarton-Format, eine Tafel an der Stirnseite als zentraler Orientierungspunkt. Diese Raumgestaltung schränkt Schulen und vor allem Schüler*innen im Alltag aber stark ein: Es gibt kaum Rückzugsmöglichkeiten, es gibt keine Wohlfühl-Oasen, es gibt keine Räume die Schüler*innen und Lehrkräfte für sich gestalten können.
Dass sich so wenig getan hat, liegt auch daran, dass den für die Schulbauten verantwortlichen Schulträgern, aber auch vielen Schulleitungen schlichtweg das Wissen über andere Möglichkeiten fehlt. Dabei gibt es zahllose innovative Konzepte – zu besichtigen zum Beispiel im Blog „Schulen planen und bauen“ der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft oder in der Fotoserie „Schulreise“ von Rahel Tschopp.
Der Unterricht erfolgt in festgelegten Fächern!
Was die Vorstellung ist:
Lernen in der Schule erfolgt in Fächern. Dabei gibt es einen tradierten Kanon – dieser stellt sicher, dass Schüler*innen über die richtige Allgemeinbildung verfügen und bereitet sie so auf Berufsausbildung und Studium vor. Wenn es neue Herausforderungen gibt, muss ggf. der Fächerkanon erweitert werden.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Der Fächerkanon der deutschen Schulen ist größtenteils seit Jahrzehnten unverändert. Auch wenn sich bei größeren Umbauten wie der Rückkehr zu G9 die Gelegenheit ergeben hätte, haben Bildungspolitiker allenfalls kosmetische Veränderungen vorgenommen. So kommt es, dass der Stundenplan der Schüler*innen heute fast noch genauso aussieht wie bei ihren Großeltern.
Dies ist insofern überraschend, dass sich der Wandel der Gesellschaft und die Entwicklung des Wissens in den vergangenen Jahrzehnten massiv beschleunigt hat. Es sind vollkommen neue Forschungsgebiete entstanden. Es geht gar nicht darum, dass es nicht wichtig ist, dass Schüler*innen bestimmte Dinge aus den tradierten Fächern wissen. Die Frage ist aber doch berechtigt, ob ein viele Jahrzehnte alter Fächerkanon wirklich noch den Anforderungen an eine Bildung in der Gegenwart genügt. Immer mal wieder kommt daher der Ruf nach neuen Fächern auf – dies scheitert aber schlichtweg daran, dass der Widerstand gegen die erforderliche Streichung anderer Fächer zu groß ist.
In den vergangen Jahrzehnten sind zudem immer mehr die Grenzen zwischen den Disziplinen immer mehr verschwommen: Interdisziplinarität ist an den Universitäten inzwischen selbstverständlich. In der Schule dagegen wird interdisziplinäres Lernen durch die Einteilung in Fächer massiv behindert. Es gibt zwar zahllose fächerübergreifende behandelte Themen, doch diese werden oft isoliert behandelt, ohne sie zu vernetzen. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass aus der Einteilung in Fächer auch bei den meisten Schulen ein starrer Stundenplan folgt – dazu später mehr.
Ein Grund für die fehlende Vernetzung ist auch, dass die Lehrpläne nicht aufeinander abgestimmt werden. Das liegt daran, dass auch hinter den Kulissen des Schulsystems viele Strukturen der Fächerlogik folgen. So werden die Lehrpläne eben von Fach-Experten ausgearbeitet. Eine Abstimmung mit den Kolleg*innen aus den anderen Fachbereichen ist nicht selbstverständlich.
Zudem verhindert die Flut der fachlichen Inhalten in den Lehrplänen eine eingehende und nachhaltige Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten. Das führt dazu, dass die Konzentration auf fachliche Inhalte oft die Möglichkeiten beim Lernen auf anderen eigentlich wichtigeren Feldern eingrenzt. Ich habe in diesem Blog zum Beispiel schon analysiert, inwiefern denken lernen, soziales Lernen, Solidariät oder Demokratie-Bildung in den Schulen zu kurz kommen.
Diese Fächerorientierung ist aber auch im Hinblick auf das Personal an den Schulen ein Problem, da bei Lehrer*innen insbesondere an den weiterführenden Schulen die fachliche Ausbildung im Mittelpunkt steht. Zum einen führt diese dazu, dass es viele Lehrkräfte gibt, die ihre Fachinhalte sehr gut, nicht aber den Umgang mit jungen Menschen beherrschen.
Zum anderen verhindert die klar definierte Rolle der Pädagog*innen als Fachlehrer*innen aber auch, dass sich echte multiprofessionelle Teams bilden: Das Dienstrecht erschwert den Quereinstieg und die Beschäftigung von Menschen, die eine andere Ausbildung haben. Wieso dürfen Schulen gerade in diesen Tagen keine Medienpädagogen beschäftigen? Wieso kann ein Schreiner-Meister keine Schulwerkstatt betreiben? Wieso kann eine Schule nicht auf eigenen Wunsch statt eines Lehrers eine(n) Schulsozialarbeiter*in einstellen?
Lernen erfolgt in einem festen Stundenplan!
Was die Vorstellung ist:
Ein Schultag ist für Lehrer*innen und Schüler*innen klar strukturiert: Sortiert nach einem festgelegten Zeitraster findet jeden Tag Unterricht in mehreren Fächern statt. Die Anzahl der Stunden pro Woche richtet sich nach einer festen Stundentafel: So wird sicher gestellt, dass Schüler*innen alles lernen, was die Lehrpläne vorsehen.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Nichts ist so maßgeblich für die Organisation des Schullebens wie der Stundenplan. Im Detail haben die Schulen zwar Gestaltungsspielräume – beispielsweise bei der Taktung (45 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten). Letztlich sind die Möglichkeiten aber stark eingeschränkt: Denn jede Lösung muss der Stundentafel entsprechen, die festlegt, wie viele Schulstunden pro Fach Schüler*innen pro Jahrgang haben müssen. Der Gestaltung der Rhythmisierung sind dadurch sehr enge Grenzen gesetzt.
Schultage sind daher für alle Beteiligten extrem durchgetaktet. Das zieht viele Probleme nach sich: So orientiert sich nicht der Zeittakt am Lernprozess, sondern der Lernprozess muss sich am Zeittakt orientieren. Schüler*innen sind immer wieder gezwungen, ihre Lern-, Denk- und Verstehensprozess zu unterbrechen und sich ganz schnell wieder auf etwas neues einzulassen. Einer fundierten Durchdringung von Gegenständen ist das sicherlich nicht förderlich.
Zudem erschwert es die Kommunikation und Kooperation ungemein: Klassenübergreifende Arbeit an einem Projekt ist beispielsweise kaum möglich, weil sie das Fach zu unterschiedlichen Zeiten haben. Und auch Lehrkräfte finden durch die unterschiedlichen Stundenpläne außerhalb der Pausen kaum ein Zeitfenster, in dem sie sich austauschen können.
Die Einschränkungen beziehen sich aber auch auf die Organisation des Personals: Lehrkräfte haben ein festes Stundenkontingent. Alle Tätigkeiten, die außerhalb des Unterrichtes erledigt werden, werden nicht gesondert erfasst. Auch für die Arbeitszeit von Lehrkräften braucht es daher bei der Organisation ihrer Arbeitszeit dringend flexiblere Lösungen jenseits des Stundenplans.
Schüler*innen lernen in einer Klasse mit Kindern ihres Jahrgangs!
Was die Vorstellung ist:
Ab dem Tag der Einschulung verbringt die Mehrzahl der Schüler*innen ihre Schulzeit mit Kindern aus demselben Jahrgang: Das Lernen erfolgt danach im Gleichschritt mit den Altersgenossen. Wechsel der Lerngruppe sind nur dauerhaft möglich – entweder man wiederholt ein Jahr oder man überspringt eine Klasse.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß: Ihre Entwicklung verläuft sehr unterschiedlich. Das gilt sowohl für ihren Körper als auch für ihren Geist und ihre charakterliche Reife. Dennoch werden Schüler*innen im Schulsystem nach Alterskohorten mehr oder minder zufällig in Lerngruppen zusammengestellt: Das führt sowohl zu Unter- als auch zur Überforderung.
Eine Öffnung der Klassen könnte dabei helfen, individuellere Lern- und Entwicklungswege zu für jedes Kind zu ermöglichen. Dabei muss man sich nicht darauf beschränken, die Klassen innerhalb eines Jahrgangs zu öffnen. Jahrgangsübergreifendes Lernen gewährt zusätzliche pädagogische Spielräume: Begabte Kinder können zum Beispiel schon mit älteren Kindern zusammenarbeiten und Kinder, die länger brauchen, müssen nicht durch ein Sitzenbleiben stigmatisiert und aus ihrem sozialen Gefüge gerissen werden.
Zudem öffnet sich für die Schüler*innen auch ein viel größerer sozialer Raum: Es gibt viele Kinder, die sich in ihrer Klasse nicht wohl fühlen. Ein Wechsel der Klasse findet aber oft nur bei ernsten Problemen statt. Eine grundsätzliche Öffnung der Klassen könnte dabei helfen, dass alle Kinder vielfältigere soziale Verbindungen knüpfen können.
Darüber hinaus erlebe ich beispielsweise in der Schülervertretung, wie fruchtbar die Zusammenarbeit zwischen Kindern verschiedener Jahrgängen ist. Die verschiedenen Perspektiven bereichern die jungen Menschen. Und sie tragen dazu bei, dass sich die Schüler*innen besser in dem sozialen Netz Schule aufgehoben fühlen, dass sich nicht nur auf eine Klasse beschränkt.
Leistungen werden mit Noten bewertet!
Was die Vorstellung ist:
Das Lernen muss benotet werden. Wenn Schüler*innen keine Noten bekommen, bringen sie keine Leistung. Die Abschaffung von Noten würde zwangsläufig zu einem Abfall der Leistungen führen. Nur wenn man Leistungen benotet herrscht Transparenz über Leistungen. Das ist auch wichtig, um Kinder auf den Wettbewerb in der Leistungsgesellschaft vorzubereiten.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Dass es Noten geben muss, wird so gut wie nie in Frage gestellt. Dass Noten eine notwendige Bedingung für Lernerfolg ist, kann man ausschließen: So gibt es etwa Finnland bis zur neunten Klasse keine Notenpflicht – und dennoch schneidet das Land in Vergleichsstudien wie Pisa immer deutlich besser als Deutschland ab.
Aus meiner Sicht haben Noten im Gegenteil sogar negative Auswirkungen auf den Lernprozess. Ich gebe mir oft Mühe zusätzlich zu der Bewertung auch ausführlichere Rückmeldungen zu geben: Was ist gut gelungen? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Meine Erfahrung ist, dass viele Schüler*innen diese Rückmeldungen kaum beachten, sondern nur Note wahrnehmen.
So tragen Noten dazu bei, dass Schüler*innen nicht aus ihren Fehlern lernen. Dabei gäbe es durchaus auch andere lernförderliche Möglichkeiten: Ein Beispiel ist das Formative Assessment, das Björn Nölte in einem Artikel für die Bundeszentrale für Politische Bildung genauer beschrieben hat: Bei dieser Methode erfolgt die Bewertung nicht am Ende, sondern fortlaufend während des Lernprozesses. Sie hat dabei mehr den Charakter einer Beratung, die Schüler*innen möglichst gute Ergebnisse ermöglichen soll.
Dadurch steht statt der Angst vor dem Scheitern der Lernerfolg im Mittelpunkt. Das wäre bitter nötig: Schon oft haben mir junge Menschen berichtet, dass sich Eltern oder Großeltern im Hinblick auf die Schule nur für die Noten interessieren: Relevant ist nicht, was gelernt wurde, wie es den Schüler*innen geht oder was sie sonst erleben, sondern was auf dem Zeugnis steht. Das ist insofern ärgerlich, als dass Noten nur ein sehr ungenaues und undifferenziertes Bild von den Leistungen von Schüler*innen liefern.
Der Fokus auf die Bewertung für fachliche Leistungen verstellt zudem den Blick auf viele andere Aspekte der Persönlichkeit der Schüler*innen. Die persönliche und soziale Entwicklung wird in Schulen so gut wie gar nicht gewürdigt – dabei steckt hier doch der eigentliche Zweck der Bildung – zumindest wenn man in den Schulgesetzen nachliest.

Leistungskontrollen erfolgen durch schriftliche Prüfungen!
Was die Vorstellung ist:
Der Lernerfolg von Schüler*innen wird vor allem an ihren Ergebnissen bei Prüfungen gemessen. Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, sollten diese möglichst standardisiert sein. In der Regel handelt es sich um schriftliche Prüfungen, bei denen die Schüler*innen vorgegebene Aufgaben unter Aufsicht in einer vorher festgelegten Arbeitszeit bearbeiten.
Was diese Vorstellung bewirkt:
Die Fokussierung auf schriftliche Prüfungen sorgt dafür, dass Lehrkräfte einen Großteil ihrer Unterrichtszeit darauf verwenden müssen, standardisierte Prüfungsformate zu üben. Die Abiturnote gibt daher mindestens genauso viel Aufschluss darüber, wie gut sich Menschen in das Korsett von Prüfungsstandards pressen können wie über ihr fachliches Know-How. Kompetenzen wie Kreativität, Improvisationskunst, Team-Arbeit spielen keine Rolle.
Zudem schränken die vorgegebenen Formate auch die Möglichkeiten ein, den Lerngegenständen angemessene Prüfungsformate zu entwickeln. So ist es zum Beispiel in der Oberstufe nur in Fremdsprachen möglich, mündliche Prüfungen statt Klausuren durchzuführen. Projekte statt Klassenarbeiten sind gar nicht erlaubt.
Durch diese Einschränkungen schränken die vorgegebene Prüfungsformate jede Schulentwicklung stark ein. Besonders weitreichende Folgen hat das für die Oberstufe: Diese ist durch die in kurzem Takt durchzuführenden Klausuren so stark reglementiert, dass pädagogische Entwicklungen kaum möglich sind.
Dabei gibt es durchaus zahlreiche Ideen für andere Prüfungsformate: Wieso arbeiten Schüler*innen nicht viel öfter in Projekten? Wieso schreiben sie nicht mehr Facharbeiten? Wieso können nicht multimediale Produkte genauso als Prüfungsleistungen anerkannt werden? Ideen für zeitgemäße Prüfungsformate gibt es genügend – zum Beispiel in dieser von Christian Albrecht und Axel Krommer initierten kollabortativ erstellten Materialsammlung.
Fazit: Neue Ideen für ein neues Paradigma
Wer die Welt verändern will, braucht ein Bild in seinem Kopf davon, wie sie sein sollte. Denn nur wenn das Ziel klar ist, lassen sich Maßnahmen planen und ergreifen, um dieses zu erreichen. Es ist zum Beispiel inzwischen nahezu unstrittig, dass CO2-Neutralität erreicht werden muss. Und auch wenn es viel Streit darüber gibt, bis wann und auf welche Weise dies geschehen soll, gibt es doch kein Zweifel am Ziel einer CO2-freien Gesellschaft.
Bei Schulen gibt es kein solches klares Ziel. Und aus meiner Sicht noch schwerwiegender: Es gibt in den meisten Köpfen kein Bild von einer Alternative. Deshalb werden die Wünsche der Mehrheit von den Menschen hinsichtlich der Schulpolitik geprägt vom alten Paradigma. Dieses muss dringend abgelöst werden.
Es geht nich um Innovation um der Innovation willen, sondern für Schulen zu sorgen, in denen Schüler*innen gerne und erfolgreich lernen. Dazu müssen die alten Vorstellungen auf den Prüfstand gestellt werden: Viele der oben beschriebenen Einschränkungen können Schulen durchaus schon jetzt aushebeln. So lange das festgefahrene Paradigma in den Köpfen der Menschen vorherrscht, werden sie dabei aber immer auf Gegenwind stoßen – von Eltern, von der Schulaufsicht, in den Medien und dadurch nicht zuletzt auch von Seiten der Bildungspolitik.
Es ist deswegen dringend nötig, trotz dieser Widerstände neue Lösungen zu entwickeln und diese auch öffentlichkeitswirksam zu verbreiten. Nur wenn neue Bilder in den Köpfen davon entstehen, was gute Schule ist, kann es zu einem Paradigmenwechsel kommen. Und erst dann werden sie zu echten Treibhäusern der Zukunft.
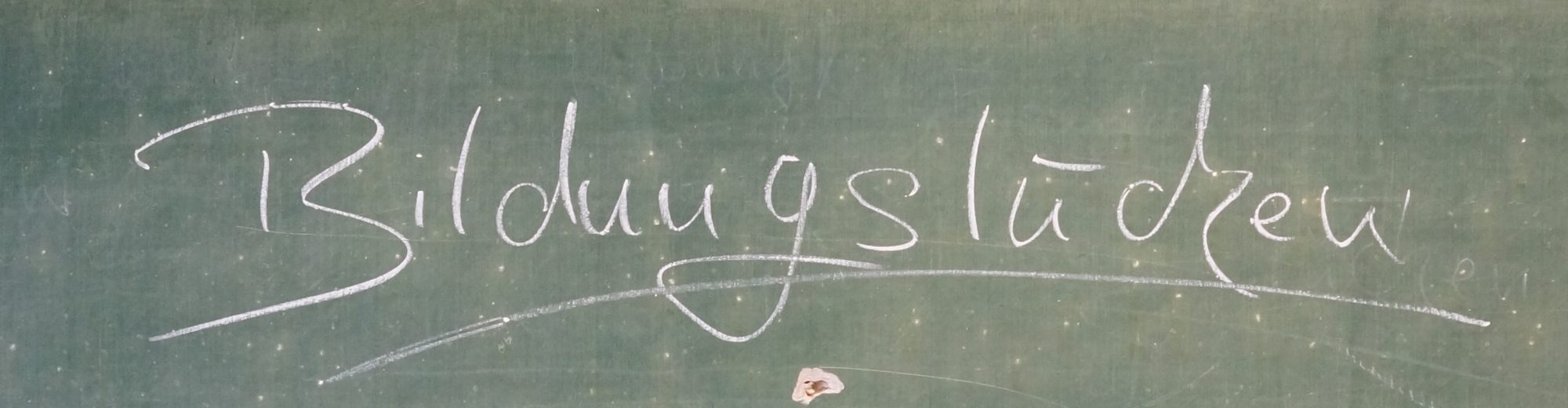

Nach Rausschmiss.
mannonmann, nicht so ernst nehmen
Artikel und die einzelnen Inhalte sind gut. Wir beackern die selben felder.
Grüße
helmut poppe
mal lesen:
https://bildungsklick.de/schule/detail/bildungspolitik-und-schulen-8-huerden-die-homeschooling-in-deutschland-verhindern
das stehe die verhinderer…
Ich habe das Glück an einer besonderen Schule zu arbeiten, in versucht wird das selbstorganisierte Lernen zu realisieren. Die neuen Formen des Unterrichts und des Lernens stehen im krassen Gegensatz zur herkömmlichem Prüfungspraxis. Die selbstständige Auswahl von Lerngelegenheiten, Reihenfolgen und Lernorten sorgt für sehr große Probleme. Man müsste die Prüfungskultur und die Lernkultur gleichzeitig ändern.