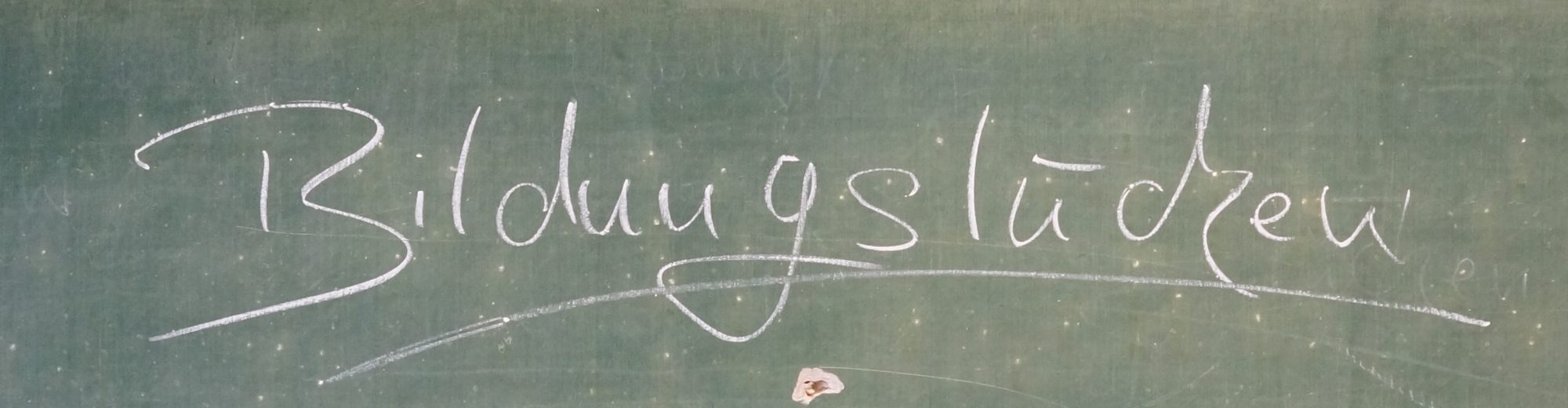Schulen sollen digital werden – da sind sich fast alle einig. Um zukunftstaugliche Bildung zu ermöglichen, muss sich in Schulen aber viel mehr ändern: Digitalisierung ist nur ein Teil im komplexen Puzzle der Schulentwicklung.
In einer Hinsicht scheint unter den Parteien vor der Bundestagswahl 2017 große Einigkeit zu herrschen: Weil Bildung wichtig ist, muss hier mehr Geld investiert werden. Einig sind sich die Bildungspolitiker auch, dass die Schulen digital werden müssen.
Ein verbesserte Ausstattung der Schulen mit IT und der Einzug digitaler Tools in den Unterricht ist ohne Zweifel wünschenswert. Es bringt aber wenig, wenn Schüler*innen digitale Technik nutzen, um ansonsten weiter zu lernen wie früher. Denn unser aktuelles Schulsystem ist keine lernfreundliche Umgebung – das habe ich in den vergangenen Monaten versucht, in einer Artikelserie zu zeigen: Wieso Lehrpläne Schüler*innen die Freude am Lernen verderben. Wieso die jungen Menschen nicht lernen zu denken oder aus ihren Fehlern zu lernen. Und warum es dem Schulsystem nicht gelingt, klassische Bildungsziele wie Autonomie, soziales Lernen oder Demokratie-Fähigkeit nachhaltig zu fördern.
An all diesen Defiziten würde eine Digitalisierung der Schulen wenig ändern. Doch wie könnte ein Schulsystem aussehen, in dem Schüler*innen gerne und viel lernen und das sie fit macht für die Herausforderungen der Zukunft? In diesem Text möchte ich die aus meiner Sicht wichtigsten Puzzle-Teile für eine zeitgemäße Schule erläutern.
4K: Die Tugenden der Zukunft – für Lehrer und Schüler
Für den Philosophen Aristoteles waren Tugenden wie Tapferkeit, Hilfsbereitschaft oder Wahrhaftigkeit der Schlüssel zu einem guten Leben. Auch wenn diese Eigenschaften sicher auch heute noch eine große Bedeutung haben, hat sich die Welt verändert: Industrialisierung, Globalisierung oder Digitalisierung haben dazu beigetragen, dass sich die Gesellschaft rasant wandelt.
Es stellt sich daher die Frage, welche Tugenden für ein Leben im 21. Jahrhundert wichtig sind. Derzeit wird in diesem Zusammenhang gerne das 4K-Modell zitiert: Um für die zukünftigen Herausforderungen fit zu sein, brauchen Schüler*innen Kreativität und die Fähigkeiten zur Kollaboration, Kommunikation und kritischem Denken (Mehr Details zu 4K liefert zum Beispiel der Blog von Dejan Mihajlovic). Auch wenn natürlich offen bleibt, ob dieser Tugend-Katalog des 21. Jahrhunderts vollständig ist, scheinen mir die 4K zumindest eine gute Orientierung zu bieten: Die Kompetenzen verbinden alte reformpädagogische Ideale mit den Anforderungen einer zunehmend technisierten Welt.
Aber schon Aristoteles hat gewusst: Es genügt nicht, um die Tugenden zu wissen. Nur durch stetige Übung lassen sich solche Charaktereigenschaften auch wirklich habitualisieren. Das bedeutet für die Schule, dass Freiräume geschaffen werden müssen, damit sich Schüler*innen in Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritischem Denken üben können. Die Herausforderung ist, die bestehenden Strukturen so zu verändern, dass Schüler diese Fähigkeiten wieder und wieder im Rahmen der Lernprozesse verbessern können.
Aristoteles hat aber auch immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Vorbilder sind: Lehrer*innen haben derzeit noch wenig Spielraum in Sachen 4K. Veränderungen im Schulsystem müssen Hindernisse für Kommunikation und Kollaboration zwischen Pädagogen beseitigen und (Zeit-)Spielräume für Kreativität schaffen.
Die Inhalte: Was sollen Schüler lernen?
Oskar Lafontaine warf einst Helmut Schmidt vor, mit den vom damaligen Kanzler hochgehaltenen Tugenden wie Pflicht und Standhaftigkeit ließe sich auch ein KZ leiten. Auch wenn solche Nazi-Vergleiche immer fragwürdig sind, bleibt doch die Frage: Sind nicht auch die 4K-Tugenden offen für Missbrauch? Schließlich stehen die 4K sicherlich auch auf der Wunschliste der Wirtschaft für den möglichst dynamischen Arbeitnehmer.
In diesem Zusammenhang stellt sich unweigerlich die Frage nach den Inhalten des Lernens. Wer kritisch denken soll, braucht dafür eine Wissensgrundlage. Manchmal hört man, es sei in Zeiten der Verfügbarkeit aller Informationen im Netz nicht mehr wichtig, dass man in Schulen Wissen vermittele, sondern nur noch die Fähigkeit, sich Wissen zu erarbeiten. Aber gibt es nicht zumindest zentrale Fragen, mit denen sich Schüler auseinander setzen sollten: Wer bin ich? Wieso ist Demokratie wichtig? Oder: Wie gehe ich mit Menschen aus anderen Kulturen um?
Die richtigen Inhalte können dabei den Wissens- und Denk-Horizont erweitern: Die Kenntnis von Theorien, Kunstwerke oder Sprachen lässt Menschen anders auf die Welt blicken. Es gilt neu darüber nachzudenken, welche Kulturgüter in einer globalisierten Welt besonderen Bildungswert besitzen.
Womöglich kann die Debatte über Inhalte, die eine solche Horizont-Erweiterung ermöglichen auch den Charakter einer Selbstvergewisserung einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft haben: Was sind die zentralen Frage und Inhalte, mit denen jeder Mensch sich beschäftigen sollte, um ein gutes Leben in einer globalisierten Gesellschaft führen zu können?
Entscheidend scheint mir dabei, dass die Schüler*innen sich wirklich ernsthaft und persönlich mit den Fragen auseinandersetzen. Das tun sie aber nur, wenn ihnen die Fragen bedeutsam erscheinen, wenn es ihre eigenen Fragen sind. Lehrpläne können obligatorische Lernfelder festhalten, sie müssen aber auch breite Freiheits-Korridore lassen, in denen Schüler*innen ihrer eigenen Neugier folgen können.
Individualisierung von Lernwegen
Nicht nur auf dem Gebiet der Inhalte ist eine Individualisierung erforderlich. Auch das Lernen selbst muss individueller werden. Die Probleme bei der Umsetzung der Inklusion an vielen Regelschulen zeigen, dass bei der Individuellen Förderung der Anspruch zwischen Realität und Praxis sehr groß ist. Das liegt auch daran, dass schon in einem „normalen“ Kurs die Heterogenität so groß ist, dass Lehrer*innen ihr kaum gerecht werden können.
Ein großes Hindernis ist dabei die Standardisierung des Bildungssystems: Bestimmt wird der Schulalltag von einheitlichen Stundentafeln und Lehrplänen. Im Rahmen der Bundestagswahl wird sogar diskutiert, dass mehr bundesweit gültige Vorgaben gelten sollen. Aber solche Standards werden die Qualität nicht sichern, sondern sie drücken: Denn am Durchschnitt orientierte Standards frustrieren Schüler*innen, denen das Lernen schwer fällt, und unterfordern begabte Kinder und Jugendliche.
Es ist daher wichtig, neue Organisationsformen für das Lernen einzuführen, die individuelle Lernwege ermöglichen. Es gibt zahlreiche bekannte und erprobte Formen, in denen Schüler viel besser individuell arbeiten können als im klassischen Unterricht: Freiarbeit, Projekt-Unterricht, Lernwerkstätten, Lerndörfer und viele mehr. Organisatorische Hindernisse, die solche Lernformen erschweren, sollten auf den Prüfstand. Dazu gehört auch der Fächerkanon: Die Trennung ist in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß und erschwert es interdisziplinär zu arbeiten und Wissen zu vernetzen.
Freiheit beim Lernen fördert Autonomie
Ein zentrales Problem bei der Individualisierung des Lernens ist der höhere Personalbedarf: Wenn Schüler*innen individuelle Lernpfade bestreiten, brauchen sie individuelle Betreuung. Das kann ein Lehrer in einer Klasse von 30 Schüler*innen nur schwer leisten. Schon bei der Inklusion hat sich gezeigt, dass es offenbar politisch nicht gewollt ist, ausreichende personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Lage wird sich angesichts eines offenbar bevorstehenden Lehrermangels wahrscheinlich auch so bald nicht verbessern. Die aus meiner Sicht einzige Hoffnung, der Herausforderung der Individualisierung Herr werden zu können, ist die Schüler*innen viel stärker in Lernprozesse einzubinden. SuS sollen viel öfter darüber entscheiden, was und wie sie lernen.
Diese Einbindung in die Steuerung der Lernprozesse dient nicht nur dazu, die personellen Defizite des deutschen Schulsystems auszugleichen, sie fördert auch das Lernen: Schüler*innen, die darüber entscheiden, was sie lernen, werden mit mehr Motivation zu Werke gehen und automatisch die Inhalte mit ihrer Lebenswelt vernetzen.
Vor allem ist eine solche Berücksichtigung des Schüler-Willens aber ein Gebot der Achtung der Würde der Schüler*innen als autonomen Wesen. Derzeit müssen sie sich für eine erfolgreiche Schulkarriere vor allem anpassen: an Prüfungsformate, an die Anforderungen ihrer Lehrer, an die Lehrpläne und den Fächerkanon. Ihre eigene Persönlichkeit entfalten können junge Menschen nur in einer Schule, die ihnen echte Autonomie beim Lernen bietet.
Von der Autonomie zur Demokratisierung
Eine solche Partizipation beim Lernen kann zudem der Ausgangspunkt für demokratischere Schulen sein. Schüler*innen, die es gewohnt sind, Einfluss auf ihre Lernprozesse zu nehmen, werden möglicherweise auch eher dazu gewillt sein, sich auf anderen Gebieten einzubringen. Wenn sie sich beim Lernen als selbstwirksam erfahren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Interessen auch auf organisatorischer Ebene einbringen.
Mehr Schüler-Partizipation ist unerlässlich, wenn die Schulen schüler-gerechter werden sollen. Schüler*innen wissen schließlich sehr viel darüber, was ihnen beim Lernen hilft. Indem sie ihre Interessen vertreten, entsteht gleichzeitig ein Lernfeld für Demokratiefähigkeit – eine Kompetenz die derzeit leider viel zu sehr vernachlässigt wird.
Schülerbeteiligung ist aber kein Selbstläufer. Es genügt nicht, die Türen und die Gremien zu öffnen. Schüler brauchen organisatorische Unterstützung bei der Selbstverwaltung, Zeit und Raum für die Partizipation, Lehrer*innen, die sie zur Partizipation motivieren. Und sie brauchen Schulleitungen, die auf ihre Wünsche eingehen.
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer
Welche Rolle spielen die Pädagog*innen in einer Schule, in der die Schüler*innen ihr Lernen künftig eigenverantwortlicher gestalten? Zum einen bleiben sie natürlich Lernbegleiter, die den jungen Menschen bei ihren Lernprozessen unterstützen und beraten. Die ihnen Orientierung in der Informationsflut bietet. Die ihnen Rückmeldungen über ihren Lernfortschritt geben.
Ein guter Lehrer sollte aber auch Inspiration bieten. Egal ob Inhalte oder Kompetenzen – bestimmte Themen und Fertigkeiten zu erarbeiten kann eine Zumutung für Schüler*innen sein. Aber gute Lehrer können Stoff zum Leuchten, zum Klingen, zum Duften bringen. Die Schüler*innen nehmen dann viel eher den Kampf mit herausfordernden Aufgaben auf, weil sie darauf vertrauen, dass es sich lohnt. Das gelingende Verhältnis zwischen Lehrer, Schüler und Stoff beschreibt Hartmut Rosa in einem Resonanzdreieck: Wenn Schule zum Resonanzraum wird, knistert es im Klassenraum im positiven Sinne.
Voraussetzung für eine solche von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit ist aber Beziehungspflege. Es muss mehr Zeit und Räume dafür geben, dass sich Lehrer und Schüler kennenlernen, miteinander austauschen, kritisieren, streiten, versöhnen können und sich über das das Lernen und ihre Zusammenarbeit auszutauschen.
Und was ist jetzt mit der Digitalisierung?
Digitalisierung sollte beim Wandel nicht nur ein neues Werkzeug sein, das die alten Utensilien ersetzt. Software und Hardware könnten richtig eingesetzt ein Hebel sein, der die bei der Veränderung aufgebrachten Kräfte vervielfacht. Übersichten wie das MIFD-Modell oder das Padagogy Wheel zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten zum Einsatz von Apps beim Lernen sind.
Digitale Medien erlauben SuS ihren Stoff neu und kreativ zu er- und verarbeiten. Sie erleichtern die Dokumentation des Lernfortschritts und den Austausch darüber zwischen Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen. Es gibt zahllose Anwendungen, die Kommunikation und Kollaboration erleichtern – vom einfachen Anwendungen wie dem Zumpad bis zu mächtigen Lernplattformen wie Moodle. Soziale Medien können Schülern dabei helfen sich untereinander zu organisieren. Und das Projekt „Aula“ zeigt, wie digitale Mitbestimmung funktionieren kann.
Die Digitalisierung könnte also einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Schulen nachhaltig zu verändern. Geld alleine reicht dafür nicht, auch zahlreiche organisatorische Hindernisse müssen beseitigt werden.
Die entscheidende Herausforderung der Zukunft wird sein, die oben beschriebenen Facetten der Schule der Zukunft miteinander zu verbinden. Es wird dabei keine Ideallösung für die Herausforderungen der Zukunft geben: Ein Gymnasium in einer gutbürgerlichen Kleinstadt wird zwangsläufig andere Wegen gehen müssen als eine Stadtteilschule in einem Brennpunktviertel einer Millionenstadt.
Eine Ausweitung der Standardisierung ist daher kontraproduktiv. Hilfreicher wäre den Schulen mehr Spielräume zu geben, eigene Wege zu gehen. Und gerade weil die anstehenden Veränderungen so komplex sind, brauchen Lehrer*innne für das Lösen dieses Schulentwicklungs-Puzzle mehr Ressourcen: Schulentwicklung ist zwar Aufgabe aller Lehrer*innen, es gibt dafür im Berufsalltag aber viel zu selten Anlässe und Zeit. Das muss sich dringend ändern.