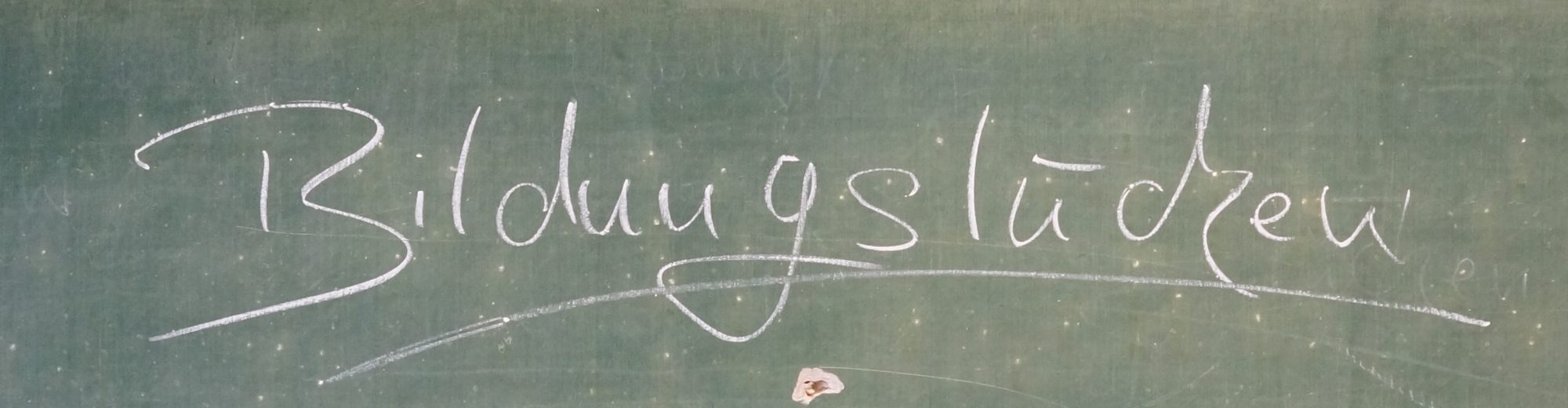Geht es nach den Kultusminister*innen der Bundesländer, sollen die Schulen nach den Sommerferien möglichst den Regelbetrieb aufnehmen. Wünschenswert ist eine Rückkehr zu einer durch Standardisierung, Prüfungsordnungen und Lehrplänen reglementierten Normalität nicht. Sowohl in Zeiten von Corona als auch danach brauchen Schüler*innen, Lehrer*innen und Schulleitungen mehr Freiheit statt Kontrollen und Vorgaben.
Noch ist es unklar, wie genau der Schulalltag nach den Sommerferien aussehen wird: Die Kultusminister*innen haben sich zwar darauf verständigt, dass wieder möglichst viel regulärer Präsenzunterricht stattfinden und die Abstandsregel fallen soll. Dies gilt aber nur, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Es bleibt also abzuwarten, ob Infektionsschutz ohne Abstand funktioniert. Zumindest regional müssen die Schulen jederzeit mit (teilweisen) Schulschließungen rechnen.
Dass die Politik eine Rückkehr zum Status-Quo vor Beginn der Corona-Pandemie anstrebt, liegt sicherlich auch daran, dass viele Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte den Regelbetrieb herbei sehnen: Viele haben die Schulschließungen als Chaos und Kontroll-Verlust erlebt, in dem viele bekannte Regelungen und Gewohnheiten nicht mehr gültig waren.
Rückkehr ins organisatorische Korsett?
Denn unter normalen Umständen ist Schule, Lernen und Bildung in ein organisatorisches Korsett gezwängt: Die Schullaufbahnen werden in komplexen Prüfungsordnungen in feste Bahnen gezwungen. Das Lernen und die Zusammenarbeit zwischen Schüler*innen und Lehrkräften ist in festen Stundenplänen organisiert. Lerninhalte sind nach Fächern sortiert und in Lehrplänen standardisiert. Der Lernzuwachs und die Leistungen werden in meist standardisierten Prüfungsformaten gemessen und bewertet. Dadurch entsteht nicht zuletzt ein Leistungsdruck, der für viele Schüler*innen der zentrale Antrieb für die Arbeit ist.
Während den Schulschließungen vor den Sommerferien fielen diese zentralen Struktur-Elemente größtenteils weg: Es entstanden so für Schulen, Lehrkräfte und Schüler*innen große Freiheitsgrade in vielerlei Hinsicht. Diese wurden von allen Seiten sehr unterschiedlich genutzt – und so war auch die Zufriedenheit mit dem Lernen auf Distanz sehr unterschiedlich ausgeprägt. Von einer Rückkehr zur „Normalität“ versprechen sich wahrscheinlich vor allem diejenigen etwas geordnetere Zustände, die schlechte Erfahrung gemacht haben.
Denn die oben beschriebenen Strukturelemente des Schulsystems suggerieren eine gewisse Sicherheit: Die Lehrkräfte steuern die Lernprozesse der Schüler*innen. Und wenn am Ende des Schuljahres die Themen im Lehrplan abgehakt sind, die Noten auf dem Zeugnis in Ordnung und die Versetzung erreicht ist, wird der vermeintliche Lernerfolg des Schuljahr sogar Schwarz auf Weiß dokumentiert.
Doch die Rückkehr zu Normalität und Kontrolle in den Schulen könnte eine trügerische Sicherheit vermitteln: Denn die oben beschriebenen starren Rahmenbedinungen schränken die Möglichkeiten der Schulen stark ein, pädagogisch sinnvolle und schülergerechte Lösungen und Konzepte zu entwickeln – sowohl während als auch nach der Pandemie. Es wäre daher sinnvoll, den Schulen möglichst mehr Freiheits-Spielräume zu geben, statt vollends zum reglementierten Regelbetrieb zurückzukehren.
Wieso brauchen Schulen Freiheit in Zeiten der Pandemie?
Möglichst genaue zentrale Standards wie Prüfungsordnungen und Lehrpläne sind immer dann sinnvoll, wenn die Rahmenbedingungen ähnlich sind: Dann können sie in Prinzip zu Bildungsgerechtigkeit beitragen, weil Schüler*innen in verschiedenen Regionen des Landes vergleichbare Lernbedingungen vorfinden.
Während der Corona-Pandemie sind einheitliche Standards aber aus verschiedenen Gründen sehr fragwürdig: Es gibt zahlreiche Voraussetzungen für das Lernen, die regional so unterschiedlich sind, dass es fragwürdig erscheint für alle Schulen in Zeiten von Corona einheitliche Regeln vorzugeben
- Infektionsgeschehen: Das Infektionsgeschehen wird sich auch weiter regional sehr stark unterscheiden. Es gibt Landkreise ohne Infektionen und es gibt Infektionsherde. Vor diesem Hintergrund wird es voraussichtlich in einigen Regionen wieder Schulschließungen geben, in anderen wird Präsenzunterricht vielleicht sogar dauerhaft möglich sein.
- Räumliche Situation: Abstand ist im Sinne des Infektionsschutz ein Gebot der Stunde. Ein großes Raumangebot erleichtert es, Möglichkeiten zu finden, dass Schüler*innen und Lehrer*innen durch Einhaltung der Mindestabstände etwas unbesorgter lernen können. Auch hier gibt es aber riesige Unterschiede bei den Schulen und auch bei den möglichen Angeboten durch Schulträger zu Ausweichräumen.
- IT-Ausstattung: Die Unterschiede bei der IT-Ausstattung von Schulen sind riesig: Bei einigen wenigen Schulen verfügen alle Schüler*innen und Lehrkräfte über ein eigenes Gerät – eine sogenannte 1:1-Ausstattung also. In Verbindung mit den passenden IT-Diensten eröffnet das sowohl in der Schule als auch von zu Hause aus vielfältige pädagogische Möglichkeiten. Es gibt aber eben auch Schulen, die kaum mit IT-Technik versorgt sind. Und auch die Voraussetzungen der Schüler*innen sind individuell und auch regional sehr unterschiedlich – sowohl was die Geräte als auch die Internet-Anbindung angeht. Diese Unterschiede führen dazu, dass Lösungen für das Distanz-Lernen nicht auf alle übertragbar sin.d
- Know-How des Kollegiums: Es ist kein Geheimnis, dass in den vergangen Jahrzehnten versäumt wurde, alle Lehrkräft und ausdrücklich auch Schulleitungen in Sachen Digitalisierung aus- und weiterzubilden. Diese Defizite können nur nach und nach aufgeholt werden. Es ist daher auch klar, dass nicht von allen Lehrkräften die gleichen Leistungen erwartet werden können.
- Personal-Ausstattung: Ein Teil der Lehrkräfte wird als Teil der Risikogruppe voraussichtlich nicht im Präsenz-Unterricht eingesetzt werden können. Eine Umfrage in Baden-Württemberg ergab zum Beispiel, dass es rund sieben Prozent sind. Dazu kommt dass natürlich auch viele Lehrkräfte Eltern sind und eigene Kinder betreuen müssen – und daher im Falle einer Schulschließung nur eingeschränkt ihre volle Leistung bringen können. Die Anteile der Lehrkräfte, die nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, wird natürlich von Schule zu Schule sehr unterschiedlich ausfallen – das ist eine große Herausforderung für die Schulleitungen.
Das alles führt zu riesigen Unterschieden bei den Lernbedingungen der Schüler*innen und den Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte während der Corona-Pandemie. Es ist daher illusorisch, von allen Kindern und Lehrkräfte weiterhin das gleiche zu erwarten. Schulen brauchen daher möglichst große Freiheiten, auf die individuellen Umstände reagieren zu können.
Wenn die Schulen auch pädagogisch den unterschiedlichen Rahmenbedingungen gerecht werden sollen, dürfen sich diese Freiheit nicht auf die Umsetzung von Hygieneplänen beschränken. Genauso wichtig wäre es, dass Schulen auch Freiheiten bei der Gestaltung von Stundentafeln und Stundenplänen erhalten, Klausuren oder die Bewertung aussetzen können oder Anforderungen der Lehrpläne reduzieren können – eben abhängig von den Umständen an ihrer jeweiligen Schule.
Warum brauchen Schulen auch ohne Pandemie Freiheit?
Womöglich erscheint es einsichtig, dass die Lehrer*innen und Schulleiter*innen Freiheiten brauchen, um während der Corona-Pandemie adäquat auf die unterschiedlichen Gegebenheiten zu reagieren. Warum aber sollte mehr Freiheit für Lehrer*innen auch unter normalen Bedingungen die Voraussetzung für schülergerechte Schulen sein? Auch hierfür sprechen zahlreiche Gründe, die im Folgenden sehr verkürzt dargestellt werden sollen.
Individualität der Schüler
Es mag wie eine Binsenweisheit klingen: Jeder Mensch ist anders. Das bedeutet aber eben auch: Jeder Mensch lernt anders. Auch viele Eltern haben in den Corona-Krise die Erfahrung gemacht, wie unterschiedliche ihre Kinder lernen. In einem Klassenraum mit 30 Kindern sind diese Unterschiede eine ungleich größere Herausforderung.
Jedes Kind bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit in den Klassenraum. Vorwissen, Begabungen, Interessen, Prägungen – und auch Defizite – ergeben sich sowohl aus der natürlichen Ausstattung als auch durch die vorschulische Erziehung und Förderung durch die Eltern. Die Standardisierung erschwert es Lehrkräften auf diese Heterogenität einzugehen.
Individualität der Lernprozesse
Die oben beschriebene Individualität der Lerner sorgt dafür, dass sich Lernen eigentlich unmöglich standardisieren lässt: Verschiedene Kinder können sich verschiedene Inhalte auf verschiedenen Wegen unterschiedlich gut aneignen. Der Lernprozess ist dabei ein komplexer psychologischer Prozess, der bis heute nur in Ansätzen verstanden ist.
Klar scheint zu sein: Schüler*innen lernen dann gut, wenn ihnen das Lernen sinnvoll erscheint. Sinn aber ist wiederum eine hochgradig individuelle Eigenschaft. Als Lehrer mache ich immer wieder die Erfahrung, dass eine Aufgabe einen Teil der Schüler*innen stark motiviert – andere dagegen, vollkommen kalt lässt. Lehrer*innen brauchen daher mehr Freiheiten bei der Gestaltung von Inhalten und Aufgaben. Motivation ist dabei nicht von außen zu steuern, sondern muss durch die Freiheit der Schüler*innen eigene individuelle Zugänge zu wählen erst ermöglicht werden.
Nicht standardisierbare Inhalte
Zu mehr Motivation könnte auch eine größere Freiheit bei Lerninhalten beitragen. Lehrpläne oder die Vorgaben für das Zentralabitur schränken die Möglichkeiten und damit manchmal auch die Freude am Lernen sehr stark ein. Zudem erschweren die Rahmenbedingungen auch das fächerübergreifende Lernen.
Selbst wenn man die Meinung vertritt, dass bestimmte Lerninhalte Pflicht sein sollten, ist doch fragwürdig, ob eindeutig benannte Zugänge und Kompetenzen wirklich dem Lernen dienen: Fördert es etwa eine intensive Auseinandersetzung mit literarischen Werken wie Goethes „Faust“, diese auf festgelegte Lernziele zu reduzieren? Dazu kommt, dass Lehrpläne oft nur ungenügend zentrale Bildungsziele adressieren, die sich nicht nicht eindeutig in Fächerkategorien packen lassen: Solidarität, soziale Kompetenzen, Demokratie oder Denken zum Beispiel spielen in den Schulen eine untergeordnete Rolle.
Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen
Das Versprechen des staatlichen Schulsystem ist, dass es Bildung für alle bietet. Bildung ist allerdings ein sehr facettenreicher Begriff. Nicht zuletzt deswegen werden in öffentlichen Diskursen immer wieder von allen Seiten Ansprüche im Hinblick auf den Bildungsauftrag formuliert: Mehr Demokratiebildung, mehr Nachhaltigkeits-Bildung, mehr MINT-Förderung. Standardisierte Lehrpläne können diesen ständig wechselnden und wachsenden Ansprüchen nur bedingt gerecht werden.
Gerade nach dem Corona-Schock rückte zum Beispiel die Digitalisierung als Bildungsfeld endgültig in den Fokus der Diskussion: Es wurde nun auch für viele Kritiker nachdrücklich sichtbar, dass Schulen die Digital-Kompetenzen der Schüler*innen besser fördern müssen. Die Frage ist aber nun, worin genau diese Kompetenzen bestehen sollen. Tatsächlich ist Digitalisierung ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Schulen noch nicht ansatzweise verstanden sind und bei dem es noch grundsätzliche Fragen zu klären gilt.
Im Besten Fall können Bildungsinstitutionen diese gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozesse mitgestalten. Dazu brauchen Lehrkräfte und Schüler*innen aber die Freiheit und die Zeit sich mit aktuellen Themen zu beschäftigen, statt einen mehrere Jahre alten Lehrplan abzuarbeiten.
Standardisierung bindet Ressourcen
Vorschriften wie Lehrpläne schränken nicht nur die Gestaltungsfreiheit ein. Zu bedenken ist auch, dass jede Regel auch Ressourcen für die Umsetzung bindet. Das gilt nicht zuletzt auch mit Blick auf die Arbeitszeit der Lehrer*innen: Einen Großteil ihrer Arbeitszeit müssen Lehrer*innen für Verwaltungsaufgaben und Formalia verwenden – zuletzt kamen etwa die deutlichen höheren Anforderungen beim Datenschutz dazu.
Der Anteil der nicht pädagogischen Aufgaben ist nicht zuletzt deshalb so groß, weil es in Schulen wenig anderes Personal gibt. Wenn Politiker neue Vorschriften und Aufgaben entwickeln, sind es immer die Lehrkräfte, die diese umsetzen müssen – unabhängig davon, ob es sich um pädagogische Aufgaben handelt oder nicht. Mehr Freiheiten bei der Einstellung von Personal würde den Schulen dabei helfen, sich auf ihre pädagogischen Aufgaben zu konzentrieren und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren.
Freiheit als Voraussetzung für Innovation
Freiräume sind die Voraussetzung für Innovation. Corona war und ist für viele Lehrkräfte eine große Herausforderung. Gleichzeitig kann die Krise aber auch eine Chance für die Schulentwicklung sein: Ich habe unlängst im Blog beschrieben, inwiefern die Pandemie durchaus auch Wege in die Lern-Zukunft weisen kann – zum Beispiel durch neue Ideen bei der Lernorganisation jenseits von Klassenraum und Stundenplan oder innovative Formen bei der Kooperation und Fortbildung im Kollegium.
Gerade weil im vergangenen Schuljahr einige Zwänge aufgehoben wurden, wehte ein Innovations-Lüftchen durch die Fluren der Schulen – spürbar zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Online-Barcamp „Schule neu denken“. Eine Rückkehr zum Business-as-Usual droht all diese neuen Ansätze zu ersticken.
Freiheit als Voraussetzung für Verantwortung und Autonomie
Der Erhalt der Freiheit könnte dazu beitragen könnte, in Schulen eine neue Kultur des Gestaltens zu etablieren. Denn nur wenn Spielräume vorhanden sind, können Lehrkräfte mehr Verantwortung für das pädagogische Handeln übernehmen und innovative und individuelle Lösungen für die Probleme vor Ort zu finden.
Es ist wenig verwunderlich, dass Schulen in der Krise vielerorts nicht selbständig agieren, sondern auf Vorgaben von den übergeordneten Behörden warten: Schulleiter und Lehrkräfte sind diese Steuerung von Oben seit Jahren gewöhnt. Schulen, die neue Wege gingen, mussten immer befürchten in den Konflikt mit den Schulbehörden zu geraten oder ihre Projekte wieder beerdigen zu müssen. Vor diesem Hintergrund sollte es nicht überraschen, wenn sie dann auch in Zeiten von Corona vielerorts auf Vorgaben von der Landesregierung warten, statt mutig eigene Konzepte zu entwickeln.(Diesen Gedanken verdanke ich nicht zuletzt den Anregungen durch die Tweets von Myrle Dziak-Mahler und Holger Müller-Hillebrand.)

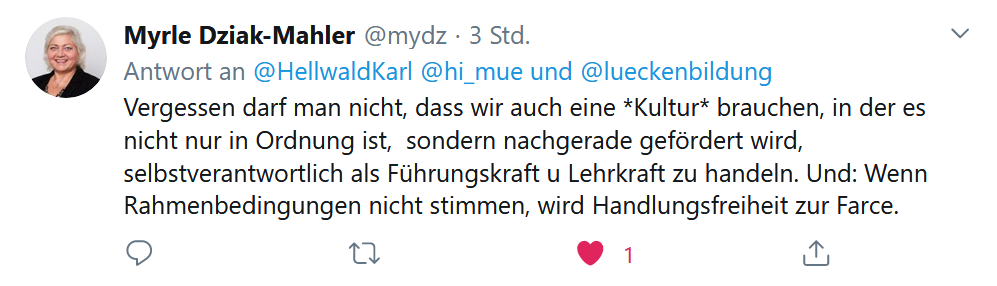
Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine solche Kultur der Gestaltungsfreiheit für Schüler*innen und Lehrer*innen in Schulen nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch Selbstzweck ist. In einer Demokratie sollte Freiheit insbesondere in Bildungsinstutionen Teil der DNA sein. Denn letztlich erscheint es unmöglich den Schüler*innen Autonomie als unbestritten zentrales Bildungsziel zu vermitteln, ohne wirklich Gestaltungsspielräume jenseits von Standardisierung, Vorschriften und Noten-Druck zuzulassen. Für echte Partizipation von Schüler*innen – zum Beispiel durch Beteiligung der Schülervertretung – brauchen Schulen aber Freiräume.
Fazit: Kontrollierter Kontrollverlust als Ziel
Bildung und Lernen sind viel zu vielschichtig, als dass wir sie einfach standardisieren und dadurch verfügbar machen könnten. Wer sich die Rahmenbedingungen in jetzigem Schulsystem anschaut, muss anerkennen, dass sie die Komplexität vieler der oben beschriebenen Aspekte schlichtweg ignoriert. Der klassische One-Size-Fits-All-Unterricht im gegliederten Schulsystem ist über diese Aspekte jahrzehntelang mehr oder weniger einfach hinweg gewalzt.
Wenn Schüler*innen und Lehrer*innen als Schulgemeinschaft diese Komplexität und Individualität von Bildung meistern sollen, brauchen sie nicht mehr, sondern weniger Kontrolle und nicht mehr, sondern weniger Standardisierung. Nur wenn Freiräume vorhanden sind können innovative Lösungen für die individuellen Herausforderungen gefunden werden.
Aus dem Ruf nach mehr Freiheit folgt ausdrücklich nicht, dass es keinerlei schulübergreifenden Vorgaben geben darf. Es ist aber die entscheidende Frage welche verbindlichen Maßstäbe nötig sind, um trotz der gebotenen Offenheit die Qualität zu sichern. Oder anders formuliert: Wie kann Kontrollverlust kontrolliert werden? Die Corona-Krise könnte ein Anlass sein, das Verhältnis zwischen Freiheit und Standardisierung an Schulen in diesem Sinne neu zu bestimmen.